Man war ja schon verdutzt, als sich 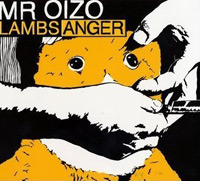 Mr. Oizo (ihr wisst schon, der mit diesem Hit aus dieser Jeans-Werbung mit „Flat Eric“) im Kontext von Ed Banger (Justice, Busy P, etc.) verortete. Neben dem oben genannten Hit schien er nämlich immer der Typ zu sein, der sich vehement gegen eine Festlegung auf einen bestimmten Sound zu wehren schien. Auf Ed Banger wiederum ist der Name des Labels weitläufig Programm. Doch Mr. Oizo macht sich zumindest ansatzweise daran, dem Ganzen ein breites Spektrum an Stilen entgegen zu setzen. Zugegeben: Die Songs auf „Lambs Anger“ treiben ohne Ende. Trotzdem verlässt sich der Künstler nicht auf einen bestimmten Style. Stattdessen regiert die Abwechslung. Und im Falle dieser Scheibe muss man sogar zugeben: das funktioniert blendend. Wie sich da elektronisches Gitarrengeballer mit minimalistischen Störgeräusch-Experimenten und poppigen Stücken a la „D.A.N.C.E“ (Justice) die Klinke in die Hand drücken. Das klingt alles so verdammt hittig, dass man meinen könnte, hier würde jemand seinen zweiten Frühling einläuten. Besonders heraus stechen das schlicht überwältigende, weil konsequent auf Euphoriebremse geschraubte, „Steroids“ mit Unterstützung der herzallerliebsten Elektro-Rap-Rakete Uffie. Und das treibende, atemlos rockende „Erreur Jean“ mit Error Smith. Dass er sich zudem auch noch dafür entschied seinen zum Gassenhauer avancierten Remix von „Killing In The Name“ nicht auf das Teil zu hieven, dürfte ihm zudem noch mehr Credibility bei der Szene verschaffen. Auch wenn sich das Teil in diesen Rahmen sicher sehr gut gemacht hätte. Trotz allem: ein tolles Album. Von einem Künstler, der erneut unter Beweis stellt, dass Unberechenbarkeit Trumpf ist, wenn man ihn im richtigen Moment ausspielt. Womit wir uns mal den allseits beliebten Rockchaoten von
Mr. Oizo (ihr wisst schon, der mit diesem Hit aus dieser Jeans-Werbung mit „Flat Eric“) im Kontext von Ed Banger (Justice, Busy P, etc.) verortete. Neben dem oben genannten Hit schien er nämlich immer der Typ zu sein, der sich vehement gegen eine Festlegung auf einen bestimmten Sound zu wehren schien. Auf Ed Banger wiederum ist der Name des Labels weitläufig Programm. Doch Mr. Oizo macht sich zumindest ansatzweise daran, dem Ganzen ein breites Spektrum an Stilen entgegen zu setzen. Zugegeben: Die Songs auf „Lambs Anger“ treiben ohne Ende. Trotzdem verlässt sich der Künstler nicht auf einen bestimmten Style. Stattdessen regiert die Abwechslung. Und im Falle dieser Scheibe muss man sogar zugeben: das funktioniert blendend. Wie sich da elektronisches Gitarrengeballer mit minimalistischen Störgeräusch-Experimenten und poppigen Stücken a la „D.A.N.C.E“ (Justice) die Klinke in die Hand drücken. Das klingt alles so verdammt hittig, dass man meinen könnte, hier würde jemand seinen zweiten Frühling einläuten. Besonders heraus stechen das schlicht überwältigende, weil konsequent auf Euphoriebremse geschraubte, „Steroids“ mit Unterstützung der herzallerliebsten Elektro-Rap-Rakete Uffie. Und das treibende, atemlos rockende „Erreur Jean“ mit Error Smith. Dass er sich zudem auch noch dafür entschied seinen zum Gassenhauer avancierten Remix von „Killing In The Name“ nicht auf das Teil zu hieven, dürfte ihm zudem noch mehr Credibility bei der Szene verschaffen. Auch wenn sich das Teil in diesen Rahmen sicher sehr gut gemacht hätte. Trotz allem: ein tolles Album. Von einem Künstler, der erneut unter Beweis stellt, dass Unberechenbarkeit Trumpf ist, wenn man ihn im richtigen Moment ausspielt. Womit wir uns mal den allseits beliebten Rockchaoten von  …And You Will Know Us By The Trail Of Dead zuwenden. Die haben als kleinen Ausblick auf ihr kommendes Album eine schicke EP namens „Festival Thyme“ in die Regale gefeuert. Die ist, wie schon die vergangenen Alben, bestückt mit hymnischen, emotional geschluchzten Gassenhauern, die sowohl den Kajal-Träger, als auch den Nostalgiker unter euch zufrieden stellen sollte. Kaum eine Band schafft es derzeit ebenso schmissige, wie anspruchsvolle Songs zusammenzubrauen, wie die Jungs aus dieser C64-„Hexenküche“. Die Vorfreude aufs nächste Album ist dementsprechend groß. Genauso, wie die Fußstapfen in die sie dank der grandiosen Vorläufer treten werden. Sollten sie das Niveau dieser EP allerdings auf Albumlänge halten können, braucht man sich um weitere, vertrackt-hymnische Rockklassiker aus dem Hause Trail Of Dead keine Sorgen zu machen. Da stampft einiges. Genau, wie bei Rise Against. Die haben zwar den Härtegrad auf ihrem neuen Album „Appeal To Reason“ gehörig gedrosselt,
…And You Will Know Us By The Trail Of Dead zuwenden. Die haben als kleinen Ausblick auf ihr kommendes Album eine schicke EP namens „Festival Thyme“ in die Regale gefeuert. Die ist, wie schon die vergangenen Alben, bestückt mit hymnischen, emotional geschluchzten Gassenhauern, die sowohl den Kajal-Träger, als auch den Nostalgiker unter euch zufrieden stellen sollte. Kaum eine Band schafft es derzeit ebenso schmissige, wie anspruchsvolle Songs zusammenzubrauen, wie die Jungs aus dieser C64-„Hexenküche“. Die Vorfreude aufs nächste Album ist dementsprechend groß. Genauso, wie die Fußstapfen in die sie dank der grandiosen Vorläufer treten werden. Sollten sie das Niveau dieser EP allerdings auf Albumlänge halten können, braucht man sich um weitere, vertrackt-hymnische Rockklassiker aus dem Hause Trail Of Dead keine Sorgen zu machen. Da stampft einiges. Genau, wie bei Rise Against. Die haben zwar den Härtegrad auf ihrem neuen Album „Appeal To Reason“ gehörig gedrosselt,  kontern diesen Umstand allerdings mit hymnischer Raffinesse. Da, wo Anti-Flag auf ihrem letzten Album immer wieder ins massenkompatible Kiesbett schlitterten, entpuppt sich die Crew um Sänger Tim McIlrath als wendiger Schlitten, der sich zielsicher seinen Weg in Richtung Rockhimmel bahnt. Neben den runderneuerten Green Day aus „American Idiot“-Zeiten und vielleicht Billy Talent (zugegeben: mit Einschränkung) dürfte es gerade keine Band geben, die dermaßen gekonnt den Brückenschlag zwischen Glaubwürdigkeit und Mainstream verkörpert. Und so sollten sie dann auch mit diesem Album endgültig zu ihrer eigenen Marke aufsteigen. Ich bin mir ziemlich sicher: diese Platte wird man in den nächsten Jahren auf jedem Zeltplatz der einschlägigen Großraumfestivals um die Ohren gehauen bekommen, was letztlich nur die bange Frage aufwirft, wie lange es wohl dauert, bis einem diese zahllosen Hymnen wieder zum Hals raushängen. Deswegen gilt auch hier: einfach mal den Moment genießen und diese Platte feiern, so lange sie frisch ist. Dann geht da einiges. Was man durchaus auch vom Debüt der schicken Indie-Combo I Heart Hiroshima behaupten kann. Die wirbeln auf „Tuff Teef“ durch einen charmanten Hagel aus Smiths-Gitarren, Los
kontern diesen Umstand allerdings mit hymnischer Raffinesse. Da, wo Anti-Flag auf ihrem letzten Album immer wieder ins massenkompatible Kiesbett schlitterten, entpuppt sich die Crew um Sänger Tim McIlrath als wendiger Schlitten, der sich zielsicher seinen Weg in Richtung Rockhimmel bahnt. Neben den runderneuerten Green Day aus „American Idiot“-Zeiten und vielleicht Billy Talent (zugegeben: mit Einschränkung) dürfte es gerade keine Band geben, die dermaßen gekonnt den Brückenschlag zwischen Glaubwürdigkeit und Mainstream verkörpert. Und so sollten sie dann auch mit diesem Album endgültig zu ihrer eigenen Marke aufsteigen. Ich bin mir ziemlich sicher: diese Platte wird man in den nächsten Jahren auf jedem Zeltplatz der einschlägigen Großraumfestivals um die Ohren gehauen bekommen, was letztlich nur die bange Frage aufwirft, wie lange es wohl dauert, bis einem diese zahllosen Hymnen wieder zum Hals raushängen. Deswegen gilt auch hier: einfach mal den Moment genießen und diese Platte feiern, so lange sie frisch ist. Dann geht da einiges. Was man durchaus auch vom Debüt der schicken Indie-Combo I Heart Hiroshima behaupten kann. Die wirbeln auf „Tuff Teef“ durch einen charmanten Hagel aus Smiths-Gitarren, Los Campesinos-Atemlosigkeit und rotziger Indie-Attitüde. Dabei klingen sie mal wie eine Brutalo-Version von Art Brut und dann wieder wie ein Überbleibsel aus glückseeligen C86-Zeiten. Die drei verzichten zudem über die volle Länge auf die Mithilfe eines Basses, was den Songs eine brutal unterproduzierte Note verleiht. Kurz gesagt: Die Indie-Crowd wird sie ganz tief ins Herz schließen für dieses kompromisslose Geholze. Und alle anderen werden sich zumindest kurzfristig davon anstecken lassen, wenn sich die beiden Gitarren miteinander prügeln. Die Protagonisten um die Wette trällern und sich poppige Melodien aus dem vorhandenen Überfluss an Sounds schälen. So ungestüm wie diese als Band getarnte Modellokomotive auf den drohenden Abgrund zurast und beim Sprung über die Klippen auch noch in die Hände klatscht, kann man sie am Ende nur lieb haben. Deswegen berauschen lassen. Und hinterher gleich wieder aus dem Trümmerhaufen krabbeln, wenn Los Campesinos! endgültig in Liga eins der euphorischsten Indie-Pop-Bands der Gegenwart vorpreschen. Der Zweitling „
Campesinos-Atemlosigkeit und rotziger Indie-Attitüde. Dabei klingen sie mal wie eine Brutalo-Version von Art Brut und dann wieder wie ein Überbleibsel aus glückseeligen C86-Zeiten. Die drei verzichten zudem über die volle Länge auf die Mithilfe eines Basses, was den Songs eine brutal unterproduzierte Note verleiht. Kurz gesagt: Die Indie-Crowd wird sie ganz tief ins Herz schließen für dieses kompromisslose Geholze. Und alle anderen werden sich zumindest kurzfristig davon anstecken lassen, wenn sich die beiden Gitarren miteinander prügeln. Die Protagonisten um die Wette trällern und sich poppige Melodien aus dem vorhandenen Überfluss an Sounds schälen. So ungestüm wie diese als Band getarnte Modellokomotive auf den drohenden Abgrund zurast und beim Sprung über die Klippen auch noch in die Hände klatscht, kann man sie am Ende nur lieb haben. Deswegen berauschen lassen. Und hinterher gleich wieder aus dem Trümmerhaufen krabbeln, wenn Los Campesinos! endgültig in Liga eins der euphorischsten Indie-Pop-Bands der Gegenwart vorpreschen. Der Zweitling „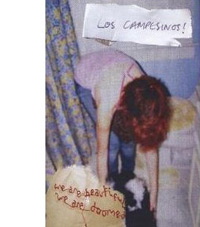 We Are Beautiful, We Are Doomed“ setzt genau dort, wo der Erstling aufhörte. Melodiebeseelter, mehrstimmiger Gesang ist das und es wirkt, als hätte die Band zwei Konfettikanonen nebeneinander aufgestellt, die sich immer wieder gegenseitig mit einem Meer aus Glitzersternen übertreffen. Die männliche und weibliche Gesangsstimmen buhlen fast im Sekundensakt um die schönste Melodie, den zauberhaftesten Refrain und die euphorischsten Momente seit… ja seit wann eigentlich? Mir fallen derzeit kaum Bands ein, die so unmittelbar und gleichzeitig Melodie besessen in die Instrument hacken, als wollten sie das überschaubare Feld der Popmusik ganz alleine umpflügen. Trotz diesem Überfluss an Sounds und Ideen wirkt die Scheibe dennoch nicht überladen. Sie macht einfach nur viel Spaß. Und ist mit ihren zehn Songs dermaßen kurzweilig, dass man am liebsten schon wieder den Nachfolger in den Händen halten würde. Was uns dann wiederum direkt zu der neuen Lieblingsband der Pete-Doherty-Fraktion bringt. Little Man Tate sind auch auf ihrem Zweitling „Nothing Worse Having Comes Easy“ die beste Post-
We Are Beautiful, We Are Doomed“ setzt genau dort, wo der Erstling aufhörte. Melodiebeseelter, mehrstimmiger Gesang ist das und es wirkt, als hätte die Band zwei Konfettikanonen nebeneinander aufgestellt, die sich immer wieder gegenseitig mit einem Meer aus Glitzersternen übertreffen. Die männliche und weibliche Gesangsstimmen buhlen fast im Sekundensakt um die schönste Melodie, den zauberhaftesten Refrain und die euphorischsten Momente seit… ja seit wann eigentlich? Mir fallen derzeit kaum Bands ein, die so unmittelbar und gleichzeitig Melodie besessen in die Instrument hacken, als wollten sie das überschaubare Feld der Popmusik ganz alleine umpflügen. Trotz diesem Überfluss an Sounds und Ideen wirkt die Scheibe dennoch nicht überladen. Sie macht einfach nur viel Spaß. Und ist mit ihren zehn Songs dermaßen kurzweilig, dass man am liebsten schon wieder den Nachfolger in den Händen halten würde. Was uns dann wiederum direkt zu der neuen Lieblingsband der Pete-Doherty-Fraktion bringt. Little Man Tate sind auch auf ihrem Zweitling „Nothing Worse Having Comes Easy“ die beste Post- Libertines Combo, die Carl und Pete vergessen haben zu gründen. Der Opener „Money Wheel“ gibt die Richtung vor. Die schrammelnden Gitarren tanzen. Die bierselige Menge tobt. Und spätesten bei „What Your Boyfriend Said“ liegen sie sich alle im Arm und feiern die anbrechende Geisterstunde. Man könnte dieses Album durchaus als den perfekten Soundtrack fürs Wochenende deklarieren. Solch euphorische Auswüchse jedenfalls hat man zuletzt weder von den Kooks, noch von den anderen Post-Libertines Klonen um die Ohren gehauen bekommen. Deshalb hüpft man auch nur zu gerne in diese große Pfütze aus Melodien und lässt sich von der Melange aus Matsch und Wasser besudeln. Manchmal muss man sich einfach mal wieder so richtig gehen lassen. Und diese „Dirty Little World“ bietet den perfekten Soundtrack dazu. Dreckig geht es ebenfalls zu auf dem Soundtrack zu „Saw 5“. Hier sei jetzt mal dahin gestellt, ob es wirklich nötig ist, das Thema noch weiter auszuschlachten.
Libertines Combo, die Carl und Pete vergessen haben zu gründen. Der Opener „Money Wheel“ gibt die Richtung vor. Die schrammelnden Gitarren tanzen. Die bierselige Menge tobt. Und spätesten bei „What Your Boyfriend Said“ liegen sie sich alle im Arm und feiern die anbrechende Geisterstunde. Man könnte dieses Album durchaus als den perfekten Soundtrack fürs Wochenende deklarieren. Solch euphorische Auswüchse jedenfalls hat man zuletzt weder von den Kooks, noch von den anderen Post-Libertines Klonen um die Ohren gehauen bekommen. Deshalb hüpft man auch nur zu gerne in diese große Pfütze aus Melodien und lässt sich von der Melange aus Matsch und Wasser besudeln. Manchmal muss man sich einfach mal wieder so richtig gehen lassen. Und diese „Dirty Little World“ bietet den perfekten Soundtrack dazu. Dreckig geht es ebenfalls zu auf dem Soundtrack zu „Saw 5“. Hier sei jetzt mal dahin gestellt, ob es wirklich nötig ist, das Thema noch weiter auszuschlachten.  War doch eigentlich spätestens nach Teil 3 bereits alles gesagt. Aber sei´s drum. Immerhin kommen wir so in den Genuss eines zähnefletschenden Soundtracks, der furios eingeleitet wird von Charlie Clousers (Ex-Nine Inch Nails) Score. Das schafft Atmosphäre, was man von den übrigen Stücken leider nicht immer behaupten kann. Zugegeben: Es wurde alles angekarrt, was in der harten Szene Rang und Namen hat: Von Ministry bis Skinny Puppy. Von Prong zu den Krupps. Von Testament bis Almighty. Aber im zweiten Teil der Scheibe ist dann doch der ein oder andere Ausfall dabei. Clutch zum Beispiel wirken schlicht deplaziert in diesem Regen des Hasses. Und immer wieder kommt die Frage auf, ob hier gegen Ende nicht die Masse an Tracks im Vordergrund stand – oder das breit gefächerte Zielpublikum. Was ja bereits das „inspired from“ in der Bildüberschrift andeutet. Alles in allem also ein zwiespältiges Erlebnis, diese Scheibe. Aber das sind Soundtracks ja meistens. Deswegen sollten Fans der härteren Gangart durchaus mal einen Durchlauf riskieren. Oder sich gleich den brachialen Klängen von United Nations hingeben. Die haben wohl in der Vergangenheit nicht nur die Mucke von Converge infiltriert, sondern auch
War doch eigentlich spätestens nach Teil 3 bereits alles gesagt. Aber sei´s drum. Immerhin kommen wir so in den Genuss eines zähnefletschenden Soundtracks, der furios eingeleitet wird von Charlie Clousers (Ex-Nine Inch Nails) Score. Das schafft Atmosphäre, was man von den übrigen Stücken leider nicht immer behaupten kann. Zugegeben: Es wurde alles angekarrt, was in der harten Szene Rang und Namen hat: Von Ministry bis Skinny Puppy. Von Prong zu den Krupps. Von Testament bis Almighty. Aber im zweiten Teil der Scheibe ist dann doch der ein oder andere Ausfall dabei. Clutch zum Beispiel wirken schlicht deplaziert in diesem Regen des Hasses. Und immer wieder kommt die Frage auf, ob hier gegen Ende nicht die Masse an Tracks im Vordergrund stand – oder das breit gefächerte Zielpublikum. Was ja bereits das „inspired from“ in der Bildüberschrift andeutet. Alles in allem also ein zwiespältiges Erlebnis, diese Scheibe. Aber das sind Soundtracks ja meistens. Deswegen sollten Fans der härteren Gangart durchaus mal einen Durchlauf riskieren. Oder sich gleich den brachialen Klängen von United Nations hingeben. Die haben wohl in der Vergangenheit nicht nur die Mucke von Converge infiltriert, sondern auch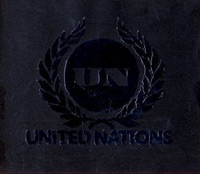 eine gehörige Portion Pop-Appeal in die Venen gespritzt bekommen. Auf ihrem gleichnamigen Debütalbum fabrizieren sie auf jeden Fall ein brachiales Gitarren-Massaker. Zwischen die lärmenden Passagen schleichen sich dabei immer wieder Erholungsphasen in Form von verschleierten Melodien. Das rückt sie wiederum in die Nähe einer Band, wie Glassjaw, mit der sie sich allerdings zu gegebenem Zeitpunkt noch nicht wirklich messen können. Macht aber nichts: wer so unberechenbar und nachdrücklich drauf los schmettert, der verdient Respekt. Schaumschläger gibt’s ja heutzutage schon zu genüge. United Nations setzen dem Ganzen eine gehörige Portion Kompromisslosigkeit entgegen. Deshalb laufen sie auch keine Gefahr, im Zuge des Hypes um härtere Klänge einfach zu verpuffen. In dieser Platte steckt etwas Nachhaltiges. Bedrückendes. Reales. Das merkt man. Und verliert sich genau deshalb nur zu gern in den düsteren Textpassagen, die in das schwarze Nichts des Frontcovers graviert wurden. Hinterher wird dann erstmal entspannt. Am besten gelingt einem das ja meistens mit einem elektronischen Mixtape der zurückgelehnten Sorte. Also hören wir mal rein in die House-Klänge, die uns Deetron
eine gehörige Portion Pop-Appeal in die Venen gespritzt bekommen. Auf ihrem gleichnamigen Debütalbum fabrizieren sie auf jeden Fall ein brachiales Gitarren-Massaker. Zwischen die lärmenden Passagen schleichen sich dabei immer wieder Erholungsphasen in Form von verschleierten Melodien. Das rückt sie wiederum in die Nähe einer Band, wie Glassjaw, mit der sie sich allerdings zu gegebenem Zeitpunkt noch nicht wirklich messen können. Macht aber nichts: wer so unberechenbar und nachdrücklich drauf los schmettert, der verdient Respekt. Schaumschläger gibt’s ja heutzutage schon zu genüge. United Nations setzen dem Ganzen eine gehörige Portion Kompromisslosigkeit entgegen. Deshalb laufen sie auch keine Gefahr, im Zuge des Hypes um härtere Klänge einfach zu verpuffen. In dieser Platte steckt etwas Nachhaltiges. Bedrückendes. Reales. Das merkt man. Und verliert sich genau deshalb nur zu gern in den düsteren Textpassagen, die in das schwarze Nichts des Frontcovers graviert wurden. Hinterher wird dann erstmal entspannt. Am besten gelingt einem das ja meistens mit einem elektronischen Mixtape der zurückgelehnten Sorte. Also hören wir mal rein in die House-Klänge, die uns Deetron  in der allseits beliebten Reihe „Fuse Presents…“ um die Ohren haut. 25 Tracks von Henrik Schwarz über Radio Slave bis hin zu Shackleton hat er auf seinem versiert zusammen gebasteltem Mix verwoben. Manche werden da nicht zu Unrecht aufschreien und sich darüber beschweren, dass das Ganze mehr oder weniger an einem vorbei läuft. Zwar wird hin und wieder Klassisches (hier dürfte wohl der Klavierunterricht aus Kindheitstagen eine entscheidende Rolle gespielt haben) und Poppiges in den Sound mit eingebunden, trotzdem läuft das Mix ohne große Höhepunkte bis zum Ende durch. Fans des Genres nennen das dann einen soliden Mix. Andere bekommen schon beim bloßen Gedanken daran intensive Gähnanfälle. Man muss dem Berner DJ und Produzenten allerdings zu Gute halten, dass er sich nicht große beirren lässt. Er zieht seinen Stiefel durch und konzentriert sich auf seine Stärken. Mit großer Raffinesse schraubt er aktuelle Tracks und einen 12 Jahre alten Remix seines DJ-Kumpels Carl Craig schlüssig zusammen. Deetron hat sich gefunden. Und zählt deshalb nicht umsonst zu den gefragtesten DJs der Gegenwart. Fans können blind zugreifen. Der Rest sollte vielleicht lieber mal die neue Label-Compilation von Kitsune anchecken. Auf „Kitsuné Maison Compilation 6“
in der allseits beliebten Reihe „Fuse Presents…“ um die Ohren haut. 25 Tracks von Henrik Schwarz über Radio Slave bis hin zu Shackleton hat er auf seinem versiert zusammen gebasteltem Mix verwoben. Manche werden da nicht zu Unrecht aufschreien und sich darüber beschweren, dass das Ganze mehr oder weniger an einem vorbei läuft. Zwar wird hin und wieder Klassisches (hier dürfte wohl der Klavierunterricht aus Kindheitstagen eine entscheidende Rolle gespielt haben) und Poppiges in den Sound mit eingebunden, trotzdem läuft das Mix ohne große Höhepunkte bis zum Ende durch. Fans des Genres nennen das dann einen soliden Mix. Andere bekommen schon beim bloßen Gedanken daran intensive Gähnanfälle. Man muss dem Berner DJ und Produzenten allerdings zu Gute halten, dass er sich nicht große beirren lässt. Er zieht seinen Stiefel durch und konzentriert sich auf seine Stärken. Mit großer Raffinesse schraubt er aktuelle Tracks und einen 12 Jahre alten Remix seines DJ-Kumpels Carl Craig schlüssig zusammen. Deetron hat sich gefunden. Und zählt deshalb nicht umsonst zu den gefragtesten DJs der Gegenwart. Fans können blind zugreifen. Der Rest sollte vielleicht lieber mal die neue Label-Compilation von Kitsune anchecken. Auf „Kitsuné Maison Compilation 6“ 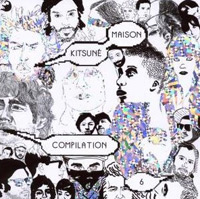 versammelt sich mal wieder das Who is Who der elektronischen Pop-Szene. Lo-Fi-Fnk schlagen auf, autoKratz servieren After-Daft Punk-Elektro-Pop-Leckereien und Etienne De Crécy sorgen zusammen mit Monsieur Jo für elektro-technoide Tanzbarkeit. Ebenfalls schön zu sehen, dass Fischerspooner mal wieder am Start sind, genauso wie die nimmermüden Jungs von Digitalism, die hier mit der (fast) Instrumentalversion von „Taken Away“ einen ihrer schönsten Tracks ever raus hauen. Im Gegensatz zu früheren Compilations der Serie wirkt dieser Teil insgesamt geschlossener. Homogener. Liegt der Schwerpunkt doch stark im elektronischen Sektor. Ausflüge in Italo-Disco-Gefilde (La Roux) bleiben eher die Ausnahme. Stattdessen gibt’s zahlreiche Remixtracks, was die Frage aufwirft, ob Kitsune sich hier nicht ein Stück weit auf bereits Erreichtem ausruhen. Immerhin warteten die alten Compilations immer wieder mit hoch gelobten Acts wie Klaxons, Bloc Party oder Hot Chip auf, kurz bevor die dann durch die Decke gingen. Hier wird stattdessen erstmal gekonnt das Feld abgesteckt, dass man in der Vergangenheit so zielstrebig beackert hat. Was am Ende bleibt ist der durchweg stimmige Gesamteindruck. Und dafür verzichtet man diesmal auch gern darauf, dass die nächsten Bloc Party noch nicht auszumachen sind. Also lasst es ordentlich krachen. Und dreht die Anlage auf zum sagenhaften Abschlussfeuerwerk von The Shoes. „Let´s Go“ verdammt noch mal… vielleicht zu den Indie-Poppern von The Wave Pictures.
versammelt sich mal wieder das Who is Who der elektronischen Pop-Szene. Lo-Fi-Fnk schlagen auf, autoKratz servieren After-Daft Punk-Elektro-Pop-Leckereien und Etienne De Crécy sorgen zusammen mit Monsieur Jo für elektro-technoide Tanzbarkeit. Ebenfalls schön zu sehen, dass Fischerspooner mal wieder am Start sind, genauso wie die nimmermüden Jungs von Digitalism, die hier mit der (fast) Instrumentalversion von „Taken Away“ einen ihrer schönsten Tracks ever raus hauen. Im Gegensatz zu früheren Compilations der Serie wirkt dieser Teil insgesamt geschlossener. Homogener. Liegt der Schwerpunkt doch stark im elektronischen Sektor. Ausflüge in Italo-Disco-Gefilde (La Roux) bleiben eher die Ausnahme. Stattdessen gibt’s zahlreiche Remixtracks, was die Frage aufwirft, ob Kitsune sich hier nicht ein Stück weit auf bereits Erreichtem ausruhen. Immerhin warteten die alten Compilations immer wieder mit hoch gelobten Acts wie Klaxons, Bloc Party oder Hot Chip auf, kurz bevor die dann durch die Decke gingen. Hier wird stattdessen erstmal gekonnt das Feld abgesteckt, dass man in der Vergangenheit so zielstrebig beackert hat. Was am Ende bleibt ist der durchweg stimmige Gesamteindruck. Und dafür verzichtet man diesmal auch gern darauf, dass die nächsten Bloc Party noch nicht auszumachen sind. Also lasst es ordentlich krachen. Und dreht die Anlage auf zum sagenhaften Abschlussfeuerwerk von The Shoes. „Let´s Go“ verdammt noch mal… vielleicht zu den Indie-Poppern von The Wave Pictures.  Die haben in ihrer Vergangenheit sehr viel britischen Gitarrenrock verinnerlicht ohne wie ein Abklatsch von den üblichen Verdächtigen zu klingen. Ganz im Gegenteil: „Instant Coffee Baby“ ist ein vielschichtiger, spannungsreicher Post-Strokes-Spielplatz, auf dem entspannt im Takt geschaukelt wird. Die Band gibt es bereits seit 1998, was zwangsläufig die Frage aufwirft, warum man das Trio nicht schon früher auf dem Bildschirm hatte. So schmissig dahin gerotzte Hits muss man derzeit nämlich mit der Lupe suchen. Diese Crew hier aber schwirrt von Glückskelch zu Glückskelch, wie ein besoffenes Individuum in einem Schwarm Bienen und fällt dabei so charmant aus der Reihe, dass man der Scheibe auch den ein oder anderen Sturzflug verzeiht. Stattdessen suhlt man sich in den lo-fi-poppigen Sounds von „Red Wine Teeth“ und verliert sich zum Gitarrensolo von „Kiss Me“ im wankelmütigen Ausdruckstanz. Die Wave Pictures beschreiben mit diesem Album eben jene Momente, wenn die Nacht am tiefsten ist und die Party langsam auszuklingen scheint. Sie vertont den Moment des Torkelns nach Hause. Und das wohlige Gefühl anschließend ins warme Bett zu plumpsen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Die haben in ihrer Vergangenheit sehr viel britischen Gitarrenrock verinnerlicht ohne wie ein Abklatsch von den üblichen Verdächtigen zu klingen. Ganz im Gegenteil: „Instant Coffee Baby“ ist ein vielschichtiger, spannungsreicher Post-Strokes-Spielplatz, auf dem entspannt im Takt geschaukelt wird. Die Band gibt es bereits seit 1998, was zwangsläufig die Frage aufwirft, warum man das Trio nicht schon früher auf dem Bildschirm hatte. So schmissig dahin gerotzte Hits muss man derzeit nämlich mit der Lupe suchen. Diese Crew hier aber schwirrt von Glückskelch zu Glückskelch, wie ein besoffenes Individuum in einem Schwarm Bienen und fällt dabei so charmant aus der Reihe, dass man der Scheibe auch den ein oder anderen Sturzflug verzeiht. Stattdessen suhlt man sich in den lo-fi-poppigen Sounds von „Red Wine Teeth“ und verliert sich zum Gitarrensolo von „Kiss Me“ im wankelmütigen Ausdruckstanz. Die Wave Pictures beschreiben mit diesem Album eben jene Momente, wenn die Nacht am tiefsten ist und die Party langsam auszuklingen scheint. Sie vertont den Moment des Torkelns nach Hause. Und das wohlige Gefühl anschließend ins warme Bett zu plumpsen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// von: alexander nickel-hopfengart
// zuckerbeat volume 41
Man war ja schon verdutzt, als sich Mr. Oizo (ihr wisst schon, der mit diesem Hit aus dieser Jeans-Werbung mit „Flat Eric“) im Kontext von Ed Banger (Justice, Busy P, etc.) verortete. Neben dem oben genannten Hit schien er nämlich immer der Typ zu sein, der sich vehement gegen eine Festlegung auf einen bestimmten Sound […]
UND WAS NUN?