Hallo ihr Pains Of Being Pure At Heart…! was ist das nur für ein verschrobenes Indie-Krach-Werk, das ihr da auf die Menschheit loslasst?! So schön geschluchzt haben zuletzt höchstens noch Evan Dando und seine Lemonheads. Im lieblichen Blumenregen tanzen dann Indiemädchen und Britpopboy fröhlich im Kreis und freuen sich des Lebens. Dieser verstrahlte Soundtrack zum Glücklichsein ist so ansteckend, das man sich fühlt wie der Rattenfänger von Hameln, der auf einmal eine ganze Reihe Grinsegesichter hinter sich herzieht, die seine Pfiffe erwidern. Die Scheibe wirkt so unscheinbar und romantisch, dass man plötzlich wieder an eine bessere Welt glauben mag. Die Menschen haben wieder dieses Glitzern in den Augen. So, als würden sie von der Musik an die Hand genommen und ihnen sanft zugeflüstert: wir haben das hier nur für dich geschrieben. Kurz gesagt: Du hast Bock auf Belle & Sebastian mit Eiern in der Hose. Hier ist deine neue Lieblingband.
Noch mehr poppige Phantasien könnt ihr euch dann bei den Virgins abholen. Die könnten durchaus als die nächsten Killers durchgehen. Also die Killers damals von Album Nummer eins. Die noch nicht so pompös einen auf Queen machten. Jedenfalls. Auf dem selbst betitelten Debütalbum hier reiht sich Hit an Hit. „She´s Expensive“, „Rich Girls“, “One Week Of Danger, „Private Affair“. Allesamt Hits für die nächste Studentenparty. Wenn die Alkohol-Bar gestürmt wird und sich Mädchen und Junge zum Knutschen aufs Sofa verziehen. Wenn im Wohnzimmer plötzlich der Lampenschirm der Eltern zum Mikrofonständer umfunktioniert wird und sich alle zu lautem Wohlfühlpop die Seele aus dem Leib schreien. Wenn du deine Beine nicht mehr spürst und die Wahrnehmung verschwimmt. Wenn du in den Armen einer/s Wildfremden vom Licht der Sonne an der Nasenspitze gekitzelt wirst. Wenn du inmitten des Chaos stehst und dir die morgendliche Zigarette reinziehst. Wenn die ganze Szenerie hinter den Rauchschwaden ins Irreale übergeht und du dir denkst: Yeah. So fühlt sich wohl die beste Zeit meines Lebens an. Und dann drehst du dich noch mal um in Richtung Stereoanlage. Schiebst den Volume-Regler nach oben, trittst durch die Türschwelle und genießt das Gefühl, dass es nicht deine Bude war, die ihr da gerade zugrunde gerichtet habt.
Etwas weniger „hauspartylicher“, aber umso clubtauglicher geht’s dann bei den Elektro-Darlings von Client zu. Da trifft verführerische New Wave-Knutsche auf breitbeinige ElektRock-Phantasie. „Command“ heißt die Synthie-Schleuder, die das Trio anno 2009 auf die tanzwütige Meute loslässt. Die Mucke klingt manchmal wie eine zeitgemäße Antwort auf Madonna, dann wieder wie ein verloren gegangener Clubentwurf, den die liebe Annie in ihrer Mottenkiste vergraben hat. Ein zwiespältiges Album also, das immer dann am meisten Spaß macht, wenn es eben nicht so offensichtlich die Hitschleuder aufspannt. Ein Song, wie „Can You Feel“ ist einfach ein Stück weit zu schillernd, um wirklich weh zu tun. Verkommt zum bloßen Beschallungsmoment für den schweißtreibenden Clubauftritt. Aber dann sind da immer wieder diese bezaubernden Momente. Der Opener „Your Love Is Like Petrol“ schlängelt sich elegant ins melancholisch getränkte Herz und auch „Ghosts“ entpuppt sich als subtil plätschernde Breitseite gegen die Unmöglichkeit einer verflossenen, aber nicht überwundenen Liebschaft. In diesen Momenten wünscht man sich, die Musik würde niemals enden. Einfach damit man sich nicht mit der Leere auseinandersetzen muss, die einen nach Verklingen des letzten Tons zu vereinnahmen scheint, wie Bankgeschäfte. Alles in allem sei dieses Album jedem ans Herz gelegt, der sich gerne an rockigen Synthesizern reibt. Auch wenn nicht jeder Track ein Treffer ist.
Das wiederum ist ja auch ein gängiges Problem bei Soundtracks. Da schleicht sich immer wieder allerhand Mist zwischen die musikalischen Perlen. Man weiß nie so genau was man kriegt. Billiges B-Movie oder knallbuntes Effektfeuerwerk. Umso schöner, dass sich die Macher des wunderbaren (da können die Kritiker noch so oft schreiben, dass der Film scheiße ist – ich find ihn klasse) Comic-Streifens „Watchmen“ dazu entschlossen haben, nur die wirklich wichtigen Hitschleudern an die Spanngurte zu lassen. Nach dem verkaufsträchtigem „Dylan“-Cover von My Chemical Romance werden hier nämlich nur die ganz Großen angekarrt, um im Schatten des blinkenden Hollywood-Banners einen Hit nach dem anderen raus zu hauen. Und klar, man könnte jetzt anmerken, dass man es hier fast ausschließlich mit altbackenem Material zu tun hat. Aber mal im Ernst: Bob Dylan, Simon And Garfunkel, Janis Joplin, Nat King Cole, Leonard Cohen, Jimi Hendrix und wie sie alle heißen. So eine Riege an Superstars kriegt man nur selten gemeinsam vor die Linse. Und so absorbieren die Superhelden der Popgeschichte das gleichförmige Chartgeblubber der Gegenwart mit ihren größten Hits – lassen die kurzweilige Popwelt von heute zerplatzen, wie Luftblasen an der Wasseroberfläche. Jedenfalls: ein gefundenes Fressen für Nostalgiker. Und mal im ernst: viele der Tracks sind einfach zu schön, um jetzt schon ein Dasein in die Analen der Popgeschichte zu fristen. Also schnappt sie euch. Und haucht der Musik neues Leben ein, wie Seelenwandler.
Die Flensburger Jungs von Alias Caylon errichten derweil mit ihrem Zweitling „Follow The Feeder“ eine schicke Sandburg der Emotionen. Soll heißen. Eigentlich ist das astreiner Emocore, aber das Wort ist ja inzwischen verpönt, deswegen kann man das auch Post-Hardcore schimpfen. Oder man beruft sich einfach auf Sunny Day Real Estate. Von denen ist die Band nämlich beeinflusst. Da darf dann auch mal etwas ausgeufert werden. Die Gitarre von der Leine gelassen und auf Songstrukturen gepfiffen werden. Geht ja um Emotionen. Um Hingabe. Um Gefühle. Nostalgisch wirkt der Sound dennoch nicht. Eher zeitlos. Wie sich hier sehnsuchtsvolles Schluchzen in Aggression transformiert. Das hört man gerne. Das strahlt eine gewisse Punk-Attitüde aus, die der Band auch immer wieder attestiert wird. Und das steht nicht im Widerspruch zu den Gitarrensoli, die hier zeitweise „rausgestöhnt“ werden. So, als ginge es darum, die Lufthoheit in der deutschen Szene voll und ganz an sich zu reißen. Als Verfechter einer spärlich vermissten Gattung von Bands, wie Texas Is The Reason oder Drive Like Jehu, die heute von allzu gleichförmigen „Produkten“ abgelöst werden, deren Funken schon wieder erloschen ist, bevor die Zündschnur überhaupt abbrennt.
Anschließend dann mal wieder ein Konzerthinweis. Die Post-NDW-Verfechter von Schwefelgelb werden am 22.5. im Pleicher Hof in Würzburg auftreten. Mit ihrem letzten Werk „Alt und neu“, das Ende letzten Jahres erschienen ist, erzeugen sie einen tanzbaren Wurf Marke D.A.F. und Konsorten. Hin und wieder erinnert das Album stark an so manche Schmonzette von Falco. Live dürfte jedenfalls ordentlich die Post abgehen, wenn sie ihre synthetisch verzerrten Hymnen, wie „Dann ist es gut“ oder „Ich hab dich gesehen“, auf die verschwitzte Menge loslassen. Ihre Liveshows sollen laut diverser Aussagen ja sowieso ein exzessives Vergnügen sein, was dem Pleicher Gewölbekeller einen verrauchten (von Blitzlicht durchlöcherten) Charme verpassen dürfte. Und wenn dann in „Stein auf Stein“ auch noch in bester Saalschutz-Manier auf „NuRave“ geschalten wird, dürfte die Emotion auch auf die hinteren Reihen überschwappen. Also gebt den Jungs mal eine Chance…
…und hört euch hinterher noch ein wenig jazz-lastige Elektronika auf Postrockflügeln an. The Antikaroshi kommen auf ihrem Album „Crushed Neocons“ ganz schön lautstark angerauscht. Hinterher versehen sie dann die komplette Straße mit musikalischen Molotow-Cocktails, indem sie die Schaufenster einschlagen und sich dort mit den passenden Instrumenten eindecken. Mit denen ballern sie dir dann astreine Rockbretter mit Postrockantrieb um die Ohren. Ein derber Mix aus experimentellen Hardcore-Anleihen und (g)riffigen Genickbrechern wird da angekarrt. Und ein durch und durch berauschendes Gefühl stellt sich ein, wenn sie ihre Instrumente vermöbeln, wie Teppichklopfer und dem alt gedienten Postrock-Genre so den Staub vom Kopf schmettern, wie Schuppenflechte. Checkt die Scheibe aus… den Sound von Antikaroshi muss man am eigenen Leib erfahren.
Hinterher wird es dann noch mal etwas undurchsichtiger. So richtig einfach wollen es DM Stith einem jedenfalls nicht machen mit ihrem Debütalbum „Heavy Ghost“. Das Ganze pendelt irgendwo zwischen Jeff Buckley und Sufjan Stevens mit einer gehörigen Portion Hall obendrauf. Ein vernebelter Schleier zieht sich durch die Songs. Dazu wird hin und wieder auf dem Klavier herum geklimpert und bei Gelegenheit auch mal zur Gitarre gegriffen. In dieser Scheibe scheint sich das komplette Spektrum zeitgenössischer Musik zu spiegeln. Himmelhochjauchzende Chöre, afrikanische Gesänge und mystische Klangexperimente schleichen sich in unterschiedlichen Schattierungen zwischen die verqueren Songstrukturen. Auf den Hörer wirkt das anfangs etwas überfordernd, aber dann entpuppt sich der Soundbrei als faszinierender Klangteppich, in dessen Fasern man sich nur zu gerne verheddert. DM Smith erzeugen mit diesem ambitionierten Werk eine detailverliebte Alternative für alle, denen das letzte Album von Antony and The Johnsons zu gleichförmig geraten ist.
Sehr wüst prügelt anschließend Derek Sherinian auf seine Gitarre ein. Der Progrocker von Dream Theater wirft auf seinem Solowerk „Molecular Heinosity“ nicht nur mit Totenschädeln um sich. Er zeigt auch noch Muse, wo sie vor Jahren ihren Sound abgebauscht haben. Insgesamt fabriziert das Album aber so einige Gähnattacken. Immer wieder möchte man dem Protagonisten einflüstern, die Sache doch mal ein bisschen weniger breitbeinig anzugehen. Die ausufernden Songstrukturen hat er diesmal zwar zu fünf bis sieben minütigen Krachern zusammengefasst. Aber so richtig warm wird man mit den Tracks trotzdem nicht. Wenn in „Ascension“ zwei Minuten lang die Gitarre jault, wie ein bemitleidenswertes Reh nach einer Auto-Attacke, dann strapaziert das ganz schön die Nerven. Wer allerdings auf Mucker-Alben steht, der sollte trotzdem mal reinhören. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
 Hallo ihr
Hallo ihr  Noch mehr poppige Phantasien könnt ihr euch dann bei den
Noch mehr poppige Phantasien könnt ihr euch dann bei den  Etwas weniger „hauspartylicher“, aber umso clubtauglicher geht’s dann bei den Elektro-Darlings von
Etwas weniger „hauspartylicher“, aber umso clubtauglicher geht’s dann bei den Elektro-Darlings von  Das wiederum ist ja auch ein gängiges Problem bei Soundtracks. Da schleicht sich immer wieder allerhand Mist zwischen die musikalischen Perlen. Man weiß nie so genau was man kriegt. Billiges B-Movie oder knallbuntes Effektfeuerwerk. Umso schöner, dass sich die Macher des wunderbaren (da können die Kritiker noch so oft schreiben, dass der Film scheiße ist – ich find ihn klasse) Comic-Streifens „
Das wiederum ist ja auch ein gängiges Problem bei Soundtracks. Da schleicht sich immer wieder allerhand Mist zwischen die musikalischen Perlen. Man weiß nie so genau was man kriegt. Billiges B-Movie oder knallbuntes Effektfeuerwerk. Umso schöner, dass sich die Macher des wunderbaren (da können die Kritiker noch so oft schreiben, dass der Film scheiße ist – ich find ihn klasse) Comic-Streifens „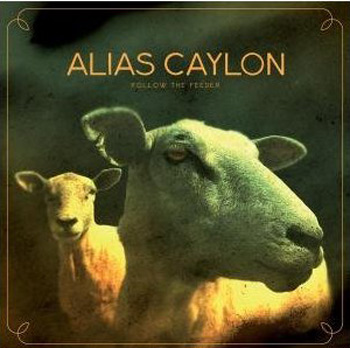 Die Flensburger Jungs von
Die Flensburger Jungs von  Anschließend dann mal wieder ein Konzerthinweis. Die Post-NDW-Verfechter von
Anschließend dann mal wieder ein Konzerthinweis. Die Post-NDW-Verfechter von 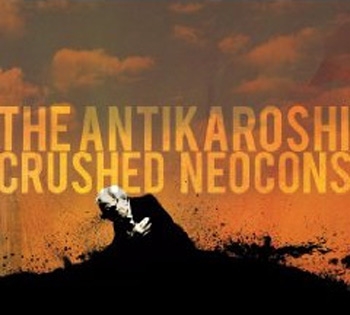 …und hört euch hinterher noch ein wenig jazz-lastige Elektronika auf Postrockflügeln an.
…und hört euch hinterher noch ein wenig jazz-lastige Elektronika auf Postrockflügeln an.  Hinterher wird es dann noch mal etwas undurchsichtiger. So richtig einfach wollen es
Hinterher wird es dann noch mal etwas undurchsichtiger. So richtig einfach wollen es  Sehr wüst prügelt anschließend
Sehr wüst prügelt anschließend
UND WAS NUN?