Wer hätte das gedacht? The Black Box Revelation aus Brüssel wollen mit ihrem ersten Album „Set Your Head On Fire“ in die Fußstapfen der ganz Großen treten. Auf ihrem Debütalbum scheint sich der Bluesrock der letzten 50 Jahre zu manifestieren. Man hört Mick Jagger schluchzen und bekommt von Jack White eins mit der Gitarre übergebraten. Dabei sind die die beiden Jungspunde Jan und Dries noch keine 20 Lenze jung und trotzdem reißen sie dich mit ihrem Sound zu Boden, wie Stolperfallen. Lassen dich nach einem fetten Patzen Erde greifen und verteilen die matschige Suppe im Raum. Getreu dem Motto: so versiert wie nötig, so stürmisch wie möglich, fahren sie den Karren immer wieder an die Wand. Wirken dabei aber so herrlich überdreht, dass die Emotionen trotzdem auf den Hörer überspringen, wie Seelenwandler. Natürlich hat man einen Song, wie „Now Alone, Always Together“ schon in ähnlicher Form von den White Stripes gehört. Aber wer so druckvoll auf seine Gitarre einprügelt, wie zuletzt höchstens noch die tollen Blood Red Shoes, dem liegt man am Ende dennoch zu Füßen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie beim Nachfolger ebenso energisch zu Werke gehen, sonst schlittern sie mit durchgetretenem Bremspedal eventuell noch ins Abseits, wie so mancher umjubelter Nachwuchs-Act vor ihnen. Bis dahin allerdings ergötzen wir uns nur zu gerne an ihrer schmissigen Breitseite Marke White Stripes und The Subways.
Hinterher wenden wir uns dann mal den cineastischen Versuchungen zu. „Slumdog Millionaire“ ist ein Film, über dessen Qualitäten sich durchaus streiten lässt. Die allzu märchenhafte Story hat allerdings einen wirklich imposanten Soundtrack abgeworfen. Angetrieben von Zugpferd M.I.A. und ihren „Paper Planes“ (hier gleich in doppelter Ausführung am Start) wird in dem Streifen ein breites Sammelsurium an hippen Weltmusik-Blitzlichtern abgefeuert, die das Autoradio in eine pulsierende Bassbox transformieren. Damit bewegt sich die Scheibe direkt am Puls der Zeit. Schließlich sind orientalisch anmutende Funkklänge derzeit in allen Clubs der Renner auf den Tanzflächen. Doch das Künstlerkollektiv um Mastermind „A R Rahman“ versteht es sehr gut, sich über gängige Klischees hinwegzusetzen. Stattdessen wird ein breites Feld an subtilen bis partytauglichen Soundentwürfen aufgefahren und für den atemlosen Charme des Films ein gelungenes Korsett generiert. Eine Scheibe, so hip, so bunt, so zeitgemäß, wie man es bei einem Soundtrack lange nicht erlebt hat. Und völlig zurecht mit dem Oscar als beste Filmmusik ausgezeichnet.
Weitere „Kicks“ verabreichen einem dann die 1990s. Auf deren neuer Hitschleuder steppt der Bär. Die Hormone spielen verrückt. Die Tanzfläche wird zum Präsentierteller für Menschen, die gerne mal einen Spagat hinlegen, um dann in bester Travolta Manier übers Parkett zu schweben, als wären sie das Jackson Update für die nächste Generation. Kurz gesagt: hier werden keine großen Gefangenen gemacht. Zu der Platte sollen sich Junge und Mädel in den Armen liegen. Sich gegenseitig die Haare durchwuscheln und eine Kissenschlacht starten. Dann trommelt der eine so lange auf den Lichtschalter ein, bis sich der andere im Blitzlicht die Kleider vom Leib reißt. Hinter der charmanten Verpackung verstecken sich 12 Indie-Perlen mit denen man nur zu gerne die Nacht durchfeiert. Ein Konzentrat der guten Laune sozusagen. Konserviert auf einem packenden Silberling. Checkt es aus.
Und gebt hinterher mal den Filthy Dukes eine Chance. Die halten nämlich den Stimmungspegel konstant am Kochen. „Nonsense In The Dark“ wirkt wie ein gut geölter Zwilling der letzten „Faint“-Scheibe. Man kommt nicht umhin der Band einen gewissen Hitappeal zu attestieren. Ist ja auch Ehrensache, wenn man schon die halbe Indie-Szene remixt hat. Und so schleicht sich auch hier der eine oder andere Gast aus dem Hause The Maccabees und Late Of The Pier zwischen den elektronischen Hagelschauer. Die stampfenden Tracks prasseln auf einen nieder, wie Reiskörner auf Hochzeitsfesten. Und sorgen so für ein abwechslungsreiches Gesamtbild, das die Chemical Brothers alt aussehen lässt, wie Opas Gehilfen. Wenn NuRave wirklich schon wieder tot ist, warum pfeifen dann eigentlich alle den Sommerhit „This Rhythm“ vor sich her, wie der Rattenfänger von Hameln? Na, weil es auf jeder Beerdigung einen guten Lacher gibt. Wussten schon Kettcar damals. Und andere vor ihnen. Die Filthy Dukes gehören ohne Zweifel auch dazu…
Deutscher HipHop erholt sich derweil wieder von seiner Aggro-Welle und schickt sich an, den einen oder anderen Künstler aus der Versenkung zu hieven, der sich mehr aufs Reimen beschränkt, als auf die dicken Klunker. Tua versteht sich derweil als wortgewandter Vertreter im Fahrwasser zeitgenössischer Dramatik. Soll heißen: Auf „Grau“ geht’s ziemlich melancholisch zu. Vergleiche mit den Sounds von Portishead sind zwar weit hergeholt. Aber mit Mike Skinner hat er zumindest das Gespür für Dramatik gemein. Überhaupt bewegen sich Tracks, wie „Bilder“ fernab jeglicher Klischees. Verzichten stellenweise sogar minutenlang auf gerappte Parts. Und so läuft das Album entspannt bis zum Ende durch, ohne dass man sich allzu groß über zwiespältige Textstellen aufregen müsste. Dass das Teil zudem auf Deluxe Records (dem Label von Samy Deluxe) erscheint, lässt den Schluss zu, dass man dort wieder auf Klasse, statt auf Masse setzt. Jedenfalls heißen wir Tua herzlich willkommen als eleganten Grenzgänger zwischen den Polen Savas und Chima. So kann es weitergehen.
Vorher blicken wir allerdings noch mal nach England. Da bastelt die 21jährige Mica Levi fröhlich an ihrer ganz persönlichen Vision von Elektro, Grime und Rap. Verkappt als Micachu startet sie ihren Streifzug durch die verhagelte Kulisse einer düsteren Zukunft. Alles lärmt und windet sich auf „Jewellery“. Mit gängigen Rapformaten hat die Scheibe in etwa so viel gemein, wie DJ Bobo mit Musik. Fast meint man, sie bedrohe ein klassisches Orchester mit einem Wasserwerfer und feuere einfach mal drauf los. Die Musik ist in keiner Weise vergleichbar mit gängigen Soundentwürfen anderer Künstler. Vielmehr meint man, Mouse On Mars würden einen Track von Lady Sovereign verwursten. Und auch wenn mancher Tune zunehmend an den Nerven zerrt, muss man doch zugeben, dass man ein solch kompromissloses Werk lange nicht mehr gehört hat. Wer sich heute schon mal ein Bild machen möchte, wie HipHop in zwanzig Jahren klingen könnte. Hier bekommt er eine Ahnung davon.
Die Black Lips hätten es sich derweil ziemlich einfach machen können. Sie hätten einen renommierten Knöpfchendreher ins Studio einladen können und der Indie-Gemeinde einen fett produzierten Wurf vor die Füße knallen können. Stattdessen allerdings haben sich die Jungs lieber auf ihre Wurzeln besonnen, eine ganze Menge Spaß gehabt und nebenbei 14 Tracks in Stein gemeiselt, die wirken, wie ein rotziges Demotape, das in einem versifften Kellerloch eingespielt wurde. Kurz gesagt: „200 Million Thousands“ ist ein schmissiges und spontanes Brett geworden mit dem sie genüsslich Plattenfirma und Zielgruppe vor den Kopf stoßen. Einen größeren Mittelfinger hätten sie der Industrie gar nicht entgegen strecken können. Vor allem, wenn man bedenkt das diese Band hier kurz davor steht, einfach nur steil nach oben zu schießen. Das Album wirkt wie ein Befreiungsschlag gegen die Gleichförmigkeit der „alternativen“ Musikszene. Ein zu diesem Zeitpunkt wirklich mutiges Werk, das bei vielen Fans für Kopfschütteln sorgen dürfte, aber ihr Image als charmante Querdenker nur umso weiter steigern dürfte.
Erinnert sich derweil eigentlich noch jemand an The Flames? Die hatten vor ein paar Jahren doch diesen schicken Sommerhit namens „Everytime“. Seitdem ist es allerdings relativ ruhig geworden um die Mannheimer Combo. Dabei hatten sie zwischenzeitlich sogar ein zweites Album am Start. Nur hat es keiner gemerkt. Wenn nun der Nachfolger „Heat Inside“ in die Plattenregale der großen Elektro-Ketten hüpft, wäre es allerdings äußert schade, würde der neue Stoff mit gute Laune Garantie dort verstauben, wie Pappkartons auf dem Speicher (für die iPod-Generation hier bitte die Worte „Datenmüll“ und „Speichermedien“ einsetzen) Jedenfalls: die Jungs karren auf dem neuen Album mal wieder eine ganze Reihe Post-Kaiser Chiefs-Hits an, die man sich ohne Bedenken auf das nächste Festivaltape spielen kann. Der Frühling machts möglich. Die Mucke hier braust ums Eck, wie Vitamintabletten und versalzt den Schwerenötern da draußen so richtig die Suppe. Dass da sicher wieder einige abwinken mit den Worten „kennichschon“ ist ebenso gesichert, wie das freudige Nicken der Partyfraktion. „Caution: Heat Inside“ ist eben Wohlfühlpop. Tut keinem weh. Und macht dosiert Spaß, wie Kids die Buchstabensuppe.
Eine Berliner Songwriterin namens Miss Kenichi macht hinterher den „Fox“. Akte X stand aber trotzdem nicht Pate für ihre Musik. Lediglich dieser melancholische Blick Mulders, wenn er schwadroniert, wie er wohl seine Schwester wieder finden könnte, der manifestiert sich in diesen Songs. Diesen sanften, zärtlichen Stücke, die fast vollständig ohne Schlagzeug auskommen. Die aber dennoch nicht zur reinen Akustik-Gähnpartie Marke Lauryn Hill (bei MTV Unplugged) verkommen. Nein, man merkt dieser Musik an, dass sie bei aller Hingabe immer ein Stück weit Pop sein möchte. Atmosphärische Klänge weisen zwar immer wieder den Weg in Richtung abseitige Gefilde, aber Sängerin Katrin Hahner steuert den Wagen versiert durchs unebene Gelände. Fast scheint es, als könnte sie einen mit ihrer Musik in eine Luftblase packen und eine gewisse Distanz zum realen Leben herstellen. Wie eine Seifenblase – bei der hofft man ja auch immer, dass sie möglichst lange vor sich hin schimmert, bevor sie lautlos im Antlitz der Sonne zerplatzt. Schön zu wissen, dass man diesen Zustand hier kontrolliert herstellen kann. Einfach „play“ drücken und schon öffnet sich das Tor zu einem anderen Universum…
Das betritt man auch, wenn man sich mal ansieht, was für ein breites Sammelsurium an elektronischen Klassikern das Label „Poker Flat“ in den letzten zehn Jahren so unter die tanzende Meute gestreut hat. Auf „All In! 10 Years Of Poker Flat“ versammelt Mastermind Steve Bug neben sich selbst allerhand Klassiker, Raritäten und Neuheiten auf drei randvollen Silberlingen, die einen in die wunderbare Welt der elektrisch aufgeladenen Szenerien geleitet. Da träumen Märtini Brös im exklusiven Plattenteil von „A Beautiful Place“. Da gibt es musikalisch Nachschub von DJ T („After Dark“) und Vincenzo („The Phantom Image“) und dann noch eine gelungene Zusammenstellung von Tracks, die in den letzten zehn Jahren das Publikum berauschten, wie Meerjungfrauen. Gerade dieser dritte Silberling namens „The Classic Tracks“ (nur bei der Special Edition der Ausgabe mit dabei) strahlt eine Erhabenheit aus, dass man sich jetzt schon auf Nachschub aus dem Hause Trentemöller und Steve Bug freut, die hier atmosphärische Bilder von großen Pianisten und melancholischen Träumereien zeichnen. Ein tolles Gesamtpaket, das Freunde der elektronischen Schwärmereien abseits von großräumiger Beschallung unbedingt mal antesten sollten.
Womit wir dann auch schon fast am Ende wären. Aber vorher noch mal bei Frightened Rabbit an die Tür klopfen und schauen, was die lieben Gitarrenpop-Schwerenöter aus Glasgow so umtreibt. „Quietly Now! – The Midnight Organ Fight Live And Acoustic At The Captain´s Rest“ entführt einen dabei gleich mit dem famosen Opener „The Modern Leper“ in ein live eingespieltes, akustisches Schlaraffenland von dem man nur zu gerne nascht. Hach, zwischenzeitlich können da sogar die Counting Crows einpacken, wenn einen Tracks wie „I Feel Better“ umschmeicheln, wie dänische Fußballikonen. Jedenfalls kann ich mich gerade nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal eine solche Freude an einer Liveaufnahme gehabt hätte. Vielleicht damals, als Dashboard Confessional bei MTV auftraten. Aber das hier: das strahlt gleichsam so karg, spröde und romantisch, dass man sein Luxusapartment kurzerhand gegen eine Bruchbude mit Aschenbecher und einer alten Matratze eintauschen würde. Dann würde man daliegen. Der Rauch der Zigarette würde den Raum durchdringen, wie Geister vergangener Tage und die brüchige Fassade des Fensters als Sinnbild aller Träume erscheinen, die sich in den Zwischenräumen des Alltags verheddert haben. Also aufstehen, rausgehen und einfach mal wieder durchatmen. Wir lesen uns beim nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
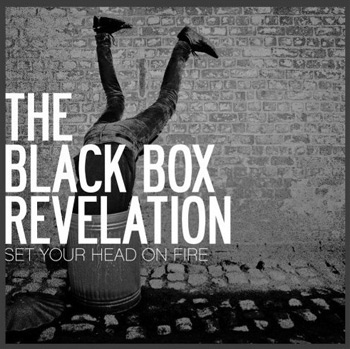 Wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht? 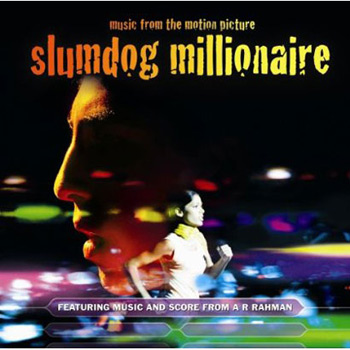 Hinterher wenden wir uns dann mal den cineastischen Versuchungen zu. „Slumdog Millionaire“ ist ein Film, über dessen Qualitäten sich durchaus streiten lässt. Die allzu märchenhafte Story hat allerdings einen wirklich imposanten Soundtrack abgeworfen. Angetrieben von Zugpferd M.I.A. und ihren „Paper Planes“ (hier gleich in doppelter Ausführung am Start) wird in dem Streifen ein breites Sammelsurium an hippen Weltmusik-Blitzlichtern abgefeuert, die das Autoradio in eine pulsierende Bassbox transformieren. Damit bewegt sich die Scheibe direkt am Puls der Zeit. Schließlich sind orientalisch anmutende Funkklänge derzeit in allen Clubs der Renner auf den Tanzflächen. Doch das Künstlerkollektiv um Mastermind „A R Rahman“ versteht es sehr gut, sich über gängige Klischees hinwegzusetzen. Stattdessen wird ein breites Feld an subtilen bis partytauglichen Soundentwürfen aufgefahren und für den atemlosen Charme des Films ein gelungenes Korsett generiert. Eine Scheibe, so hip, so bunt, so zeitgemäß, wie man es bei einem Soundtrack lange nicht erlebt hat. Und völlig zurecht mit dem Oscar als beste Filmmusik ausgezeichnet.
Hinterher wenden wir uns dann mal den cineastischen Versuchungen zu. „Slumdog Millionaire“ ist ein Film, über dessen Qualitäten sich durchaus streiten lässt. Die allzu märchenhafte Story hat allerdings einen wirklich imposanten Soundtrack abgeworfen. Angetrieben von Zugpferd M.I.A. und ihren „Paper Planes“ (hier gleich in doppelter Ausführung am Start) wird in dem Streifen ein breites Sammelsurium an hippen Weltmusik-Blitzlichtern abgefeuert, die das Autoradio in eine pulsierende Bassbox transformieren. Damit bewegt sich die Scheibe direkt am Puls der Zeit. Schließlich sind orientalisch anmutende Funkklänge derzeit in allen Clubs der Renner auf den Tanzflächen. Doch das Künstlerkollektiv um Mastermind „A R Rahman“ versteht es sehr gut, sich über gängige Klischees hinwegzusetzen. Stattdessen wird ein breites Feld an subtilen bis partytauglichen Soundentwürfen aufgefahren und für den atemlosen Charme des Films ein gelungenes Korsett generiert. Eine Scheibe, so hip, so bunt, so zeitgemäß, wie man es bei einem Soundtrack lange nicht erlebt hat. Und völlig zurecht mit dem Oscar als beste Filmmusik ausgezeichnet. Weitere „Kicks“ verabreichen einem dann die
Weitere „Kicks“ verabreichen einem dann die  Und gebt hinterher mal den
Und gebt hinterher mal den  Deutscher HipHop erholt sich derweil wieder von seiner Aggro-Welle und schickt sich an, den einen oder anderen Künstler aus der Versenkung zu hieven, der sich mehr aufs Reimen beschränkt, als auf die dicken Klunker. Tua versteht sich derweil als wortgewandter Vertreter im Fahrwasser zeitgenössischer Dramatik. Soll heißen: Auf „Grau“ geht’s ziemlich melancholisch zu. Vergleiche mit den Sounds von Portishead sind zwar weit hergeholt. Aber mit Mike Skinner hat er zumindest das Gespür für Dramatik gemein. Überhaupt bewegen sich Tracks, wie „Bilder“ fernab jeglicher Klischees. Verzichten stellenweise sogar minutenlang auf gerappte Parts. Und so läuft das Album entspannt bis zum Ende durch, ohne dass man sich allzu groß über zwiespältige Textstellen aufregen müsste. Dass das Teil zudem auf Deluxe Records (dem Label von Samy Deluxe) erscheint, lässt den Schluss zu, dass man dort wieder auf Klasse, statt auf Masse setzt. Jedenfalls heißen wir Tua herzlich willkommen als eleganten Grenzgänger zwischen den Polen Savas und Chima. So kann es weitergehen.
Deutscher HipHop erholt sich derweil wieder von seiner Aggro-Welle und schickt sich an, den einen oder anderen Künstler aus der Versenkung zu hieven, der sich mehr aufs Reimen beschränkt, als auf die dicken Klunker. Tua versteht sich derweil als wortgewandter Vertreter im Fahrwasser zeitgenössischer Dramatik. Soll heißen: Auf „Grau“ geht’s ziemlich melancholisch zu. Vergleiche mit den Sounds von Portishead sind zwar weit hergeholt. Aber mit Mike Skinner hat er zumindest das Gespür für Dramatik gemein. Überhaupt bewegen sich Tracks, wie „Bilder“ fernab jeglicher Klischees. Verzichten stellenweise sogar minutenlang auf gerappte Parts. Und so läuft das Album entspannt bis zum Ende durch, ohne dass man sich allzu groß über zwiespältige Textstellen aufregen müsste. Dass das Teil zudem auf Deluxe Records (dem Label von Samy Deluxe) erscheint, lässt den Schluss zu, dass man dort wieder auf Klasse, statt auf Masse setzt. Jedenfalls heißen wir Tua herzlich willkommen als eleganten Grenzgänger zwischen den Polen Savas und Chima. So kann es weitergehen. Vorher blicken wir allerdings noch mal nach England. Da bastelt die 21jährige Mica Levi fröhlich an ihrer ganz persönlichen Vision von Elektro, Grime und Rap. Verkappt als
Vorher blicken wir allerdings noch mal nach England. Da bastelt die 21jährige Mica Levi fröhlich an ihrer ganz persönlichen Vision von Elektro, Grime und Rap. Verkappt als 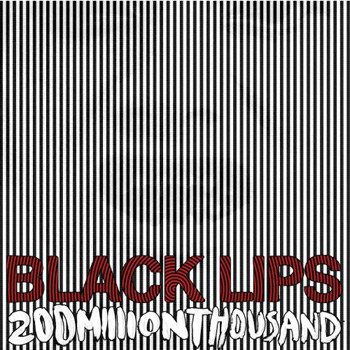 Die
Die  Erinnert sich derweil eigentlich noch jemand an
Erinnert sich derweil eigentlich noch jemand an  Eine Berliner Songwriterin namens
Eine Berliner Songwriterin namens  Das betritt man auch, wenn man sich mal ansieht, was für ein breites Sammelsurium an elektronischen Klassikern das Label „Poker Flat“ in den letzten zehn Jahren so unter die tanzende Meute gestreut hat. Auf „
Das betritt man auch, wenn man sich mal ansieht, was für ein breites Sammelsurium an elektronischen Klassikern das Label „Poker Flat“ in den letzten zehn Jahren so unter die tanzende Meute gestreut hat. Auf „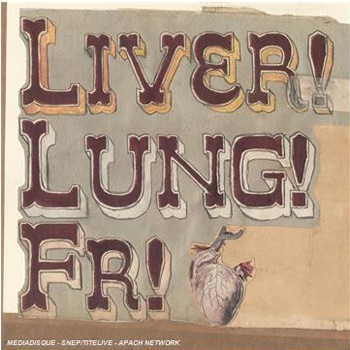 Womit wir dann auch schon fast am Ende wären. Aber vorher noch mal bei
Womit wir dann auch schon fast am Ende wären. Aber vorher noch mal bei
UND WAS NUN?