Puh, das muss ich jetzt erstmal schlucken. Scott Matthew hat ein neues Album draußen. Viele werden erstmal mit den Achseln zucken. Den Künstler hat man ja nicht unbedingt auf dem Schirm. Doch es ist nie zu spät, nachzuziehen. Quer einzusteigen. Und dann auf die Überholspur zu wechseln und den Backkatalog von hinten aufzuarbeiten. Wobei: Ist ja eigentlich erst sein zweites Album. Schon der Titel klingt famos: „There Is An Ocean That Divides And With My Longing I Can Charge It With A Voltage Thats So Violent That To Cross It Could Mean Death”. Kurz und bündig übersetzt, heißt das so viel, wie: hier kommt mein Meisterstück. Die Musik ist von einer solchen Traurigkeit durchzogen, dass man sich der Sache nicht entziehen kann. Draußen schlagen sie Purzelbäume auf der Wiese, knutschen, pflücken Blumen, freuen sich des Lebens und hier drinnen, inmitten dessen was da aus der Anlage strömt, da geht einfach nur die Welt zugrunde. Da bricht ein ganzes Leben in sich zusammen, weil einen diese Stimme in ihren Bann gezogen hat. Einen nicht mehr loslässt. Sich festbeißt. Einen mit sich selbst konfrontiert. Mit der inneren Leere. Kurz bevor man endgültig gen Abgrund gerissen wird, schält sich dann das beschwingte „Ornament“ in die Gehörgänge. Tut so, als wäre gar nichts gewesen. Rüttelt einen auf und nimmt einen anschließend fest in den Arm. Wer auch immer mal geschrieben hat, eine Platte wäre der beste Freund des Menschen. Scott Matthew springt ihm mit diesem Song zur Seite. Aber Vorsicht: seine Musik ist hinterhältig. Dieses Album gaukelt einem vor, es gäbe Hoffnung, aber dann reißt es einen noch weiter nach unten. Bis zum Grund. Wenn es denn überhaupt einen gibt. Und klingt dabei so einzigartig, dass man sich wünscht, diese Musik würde nie enden. Jeder der sich an den melancholischen Tönen von Soap & Skin erfreute, der wird diese Musik ganz tief ins Herz schließen. Er wird die Scheibe hüten wie einen Schatz. Er wird nicht mehr von der Platte ablassen, vielleicht auch in der Hoffnung, es würde sich irgendwann ein Gefühl der Gleichgültigkeit einstellen. Aber Distanz steht bei Scott Matthew nicht auf der Agenda. Man ist entweder drin oder draußen. Für mehr oder weniger ist diese Musik nicht zu haben. Und das ist verdammt noch mal gut so.
Wenn der liebe Rocko Schamoni hinterher dann einen Film zu seinem Buch „Dorfpunks“ raus haut, dann lässt sich die Szene natürlich nicht lange bitten. Die wollen dann auch alle auf dem Soundtrack sein. Also Vorhang auf für die schönste „Punk und sonst so“-Compilation des Jahres. Gleich zu Beginn wird das System von Slime zu Grabe getragen und wer weiß: in Zeiten der Finanzkrise ist das vielleicht gar nicht so schwer zu bewerkstelligen. Hinterher folgen dann die Fehlfarben, Buzzcocks, Siouxsie & The Banshees, Stiff Little Fingers und zum Abschluss noch die „Dorfpunk All Stars“ mit ihrem famosen Hüftschwinger „Rand der Scheibe“. Kann ja nun wirklich nicht schaden bei so frühlingshafter Atmosphäre auch noch einen echten Tanzboden Smash-Hit aus den Boxen zu ballern. Alles in allem ein echter Hammer, das Teil. Sogar die Promo ist voll punk, ey… ist halt echt gebrannt. Welche Marketingfirma sich das wohl wieder aus dem Ärmel geschüttelt hat? Wie auch immer… geiles Teil. Sollte man auf Tape veröffentlichen. Oder auf Rohling mit aufgemalten Mittelfinger. Aber wo waren wir noch gleich? Ach ja…
Frühling ist, Maikäfer fliegen. Grashüpfer, ähm, hüpfen. Au Revoir Simone scheinen sich davon anstecken zu lassen. War der Vorgänger noch vorwiegend von so einer Düster Atmosphäre a la David Lynch durchflutet, darf jetzt mal wieder gepoppt werden. Der Albumtitel „Still Night, Still Light“ gibt die Richtung vor. Die neue Scheibe ist ein Morgengrauen-Album. Die Sonne schimmert durch das Geäst der Bäume. Die Maikäfer fliegen und die Grashüpfer, ähm, hüpfen. Jedenfalls verdreht einem die Musik ganz schön den Kopf. Alles wirkt so benebelt, wie Räucherstäbchen. Man kann gar nicht klar denken. Grad so beim Schreiben. Da muss man aufpassen, dass man nicht alles doppelt hinschreibt. Hab ich schon erwähnt, dass das hier ein Morgengrauen Album ist? Hab ich? Ich meine, schon das Bild vorne drauf. Einfach zauberhaft. So erhaben. Wie eine Erlösungsszene aus einem alten Vampirfilm. Mit diesem Album öffnen die Mädels von Au Revoir Simone das Tor zu einer anderen Welt. Sie vertreiben die Geschöpfe der Dunkelheit, wie die Ghostbusters. Müssen sie ja auch. Ist ja Frühling: Maikäfer fliegen, Grashüpfer… ach so, das hatten wir glaub ich schon… alles in allem ein hinreißendes Album. Geradezu verwirrend schön.
Anschließend schauen wir dann mal auf einen Sprung bei Sebastien Grainger & The Mountains vorbei und schlagen auf die Luftgitarre ein, bis die Strahlen der Sonne am Horizont verklingen. Also los: Einfach mal wieder auf eine Strandparty stürmen. Der Techno-DJ wird von der Kuppel gestoßen und der Verstärker eingestöpselt. E-Gitarre ausgepackt und ab dafür. Partymucke kann so schön sein. RoggnRoll Alder. Und war ja auch klar, dass der Sebastien das hinkriegt. Der hat ja auch schon als Drummer der Elektro-Gebrüder „Death From Above 1979“ voll auf die Kacke gehauen. Die Musik fühlt sich an, als würde man auf eine Spitzhacke treten. Da gibt’s voll auf die Fresse. Wer auf hymnische Rockmusik steht, der kommt an dieser Scheibe nicht vorbei. Das ist Musik, aufbrausend, wie Vitamintabletten. Melodien für den verrockten Frühling. Der perfekte Soundtrack für die nächste Abrissparty. Aufgeschürfte-Jeans-Fraktion. Bitte Regler hoch und ab dafür. Es lohnt sich.
Und jetzt aber… geht doch! Deutsche HipHop mit Wortspielen hat noch lange nicht ausgedient. Einfach mal Flowin Immo Et Les Freaqz fragen. Der Song beim Bundesvision Songcontest hat ja schon die Richtung vorgegeben: Geht nicht, gibt’s nicht in Freakhausen. „Immoment“ wird er damit zwar nicht die Spitze der Charts erklimmen, aber für viele Menschen ein wichtiger Begleiter auf ihrem Lebensweg bleiben. Soll heißen: da wo Jan Delay zuletzt wortspieltechnisch zu Gunsten der Popmusik Kompromisse einging, da setzt Immo auf Konsequenz. Kurz gesagt. Erst Kopf anstrengen und dann die musikalische Vielfalt genießen: Rappen, Singen, Funken, Poppen, Schlagern, Rocken. Alles darf. Nichts muss. Und man wünscht sich wirklich, dass dieses Teil hier durch die Decke geht. Mit Clueso sollte es doch endlich klappen. Der ist nämlich auch am Start. Auf „So Easy“ – dem ultimativen Hit der Scheibe. Da kombiniert Immo Haltung mit Massengeschmack. Ohne Anbiederung. Die beiden Reimpoeten kennen sich nämlich schon seit Kindheitstagen. Also anchecken. Und zwar immer und immo-wieder. Ist doch so, wie Immo imma zu sagen pflegt: „Eins und eins ist mehr als Zweifel“. Na eben…
Hinterher wagen wir mal einen kleinen Abstecher nach Island. Da solls ja bekanntlich sehr gemütlich zugehen. Hjaltalín passen da also perfekt rein. Die Band hat nicht nur den „Icelandic Music Award“ fürs beste Songwriting abgestaubt. Sie bewegt sich auch ziemlich ansehnlich zwischen den Polen Sigur Ros und Arcade Fire. Ein Hauch von Balkan-Schwärmerei durchzieht die ruhigen Songs, die sich immer wieder zu euphorischen Fanfaren aufschwingen. Überhaupt ist „Sleepdrunk Seasons“ gar nicht so melancholisch, wie man es erwartet hätte. Ganz im Gegenteil. Die Musik klingt ziemlich unberechenbar. Erst lullt einen die Band mit schwelgerischen Tönen ein und dann lädt sie zum Tanzen ein. Man fühlt sich, wie nachts im Stadtpark. Wenn Hase und Igel sich Gute Nacht sagen, rufen die Nachteulen von Hjaltalín zur großen Party auf. Da wird dann nicht nur mit den Füßen gewippt, sondern auch mal geknutscht. Und wenn einen morgens die ersten Sonnenstrahlen an den Zehen kitzeln, könnte man glatt in Nostalgie verfallen. Dieses Album bringt einen back to the basics. Zu den Dingen, die wirklich wichtig sind. Hjaltalín machen Naturkunde-Pop. Perfekt zum auf der Wiese liegen. Alle Tagträumer unter euch: Lasst euch die Scheibe nicht entgehen.
Anschließend machen dann Art Brut auf ihrem dritten Album genau dort weiter, wo sie beim Erstling angefangen haben. Das neue Werk mit dem charmant größenwahnsinnigen Titel „Art Brut Vs. Satan“ poltert gleich mal dermaßen schmissig drauf los, dass man sich fühlt wie beim Baseballspielen. Durchziehen und los. Und hinterher ohne Rücksicht auf Verluste die Tanzfläche gestürmt und großspurig drauf los gewippt. Art Brut waren ja schon immer ein Act der lautstarken Sorte. Auch auf Platte Nummer drei hat sich daran nichts geändert. Stattdessen bekommen alle Fans des selbstironischen Augenzwinkerns hier den vollen Dampfhammer in Sachen inkorrekte Partymucke. Die Frage, wie lange sie damit noch durchkommen, stellt sich schon deshalb nicht, weil die Texte mal wieder so dermaßen famos sind, dass man sich die Hälfte davon aufs nächste Lieblings-Shirt drucken möchte. Und zwar innenrein. Als Understatement. Mit dieser Platte zeigen Art Brut wie Größenwahn klingen kann. The Hives. Bitte nachlegen! Und Art Brut, bitte nicht aufgeben. Irgendwann wird euch die Welt für Alben wie diese dankbar sein.
Womit wir schließlich bei „Coaster“ angekommen wären – so heißt das neue Werk aus dem Hause NOFX und fast scheint es, als hätten sich die Jungs (na ja, sagen wir mal Punkrockgötter) dazu entschlossen, diesmal einfach auf Füllmaterial zu scheißen. Soll heißen. 12 Songs – 12 Hits. Schon die erste Single „The Quitter“ verteilt so derbe Arschtritte mit gitarrenlastiger Melodieseligkeit, dass man euphorisch im Kreis hüpft. Ist das jetzt Einbildung oder sind die Jungs trotzdem mit dem Alter etwas milder geworden? Manche der Songs sind geradezu anmaßend mid-tempo-lastig. Das macht wiederum nix, weil jeder Track ein verdammter Hit ist. Und „My Orphan Year“ und „Eddie, Bruce & Paul“ laden ja trotzdem gut zum Rumpogen ein. Während sich bei anderen Bands beim elften Studioalbum gewisse Ermüdungserscheinungen breit machen, spielen NOFX auch nach 25 Jahren Bandgeschichte immer noch 99 Prozent der amerikanischen Punkrockszene an die Wand. Die Lyrics sind gewohnt gewitzt (auch wenn man den Humor von den Jungs nicht unbedingt teilen muss). Kurz gesagt. Kleines Album, viel dahinter. Besser konnte der Punkrockfrühling gar nicht beginnen. Also los: Pogo durchs Gänseblümchenfeld. Und dann braten wir unseren Arsch in der Sonne und surfen zu den Ska Sounds von „Best God in Show“ über die Poser-Promenade vom örtlichen Stadtstrand. Sommer, ich komme.
Vorher widme ich mich allerdings noch einem weiteren musikalischen Schmankerl aus dem Hause Frank Popp. Louis Lament sind schon als Support von Mother Tongue durch die Clubs getourt und von „Visions“ als eine der größten Versuchungen des Jahres 2008 gehandelt worden. Jetzt haben sie ihr Album „Golden Fleece“ vorgelegt und verwandeln den Rockclub in eine Funk-Station. Hier wird nicht wild drauf los gebrettert, sondern fröhlich im Takt gewippt und die Hüfte geschwungen. Die Songs sind allesamt sehr tanzbar geraten, dennoch vermisst man so ein bisschen das eigenständige Element. Dass die Scheibe dennoch gut durchläuft, gerade bei solch frühlingshafter Atmosphäre, liegt vor allem daran, dass das hier eigentlich genau das Album ist, dass man sich von Lenny Kravitz immer gewünscht hätte. Soll heißen: die Scheibe rockt. Und wir warten mal ab, wie es weitergeht. Ist schließlich nicht ganz einfach, als größte Hoffnung 2008 anno 2009 immer noch nicht in den Gehörgängen der Discogänger verankert zu sein.
In ganz anderen Gewässern treibt sich das, von flächigen Ambient-Sounds und Pianoklängen eingeleitete, „Insides“ von Jon Hopkins herum. Bevor sich die anfangs zärtlichen, dann bisweilen mysteriösen Synthesizer-Sounds an den Hörer heran pirschen, wähnt man sich noch weitestgehend in Sicherheit. Man meint, man wäre den Beweggründen dieses Künstlers bereits auf die Schliche gekommen, dann führt er einen mit seiner Musik aber immer wieder an der Nase herum. Manchmal schimmert die verträumte Atmosphäre von M83 zwischen den Zeilen hindurch, bevor ein Glockenspiel die vordergründige Idylle mit seiner verstörenden Aura zerfetzt und ein synthetischer Wutausbruch alles in Grund und Boden walzt. Ich kann mir nicht helfen, aber in Bezug auf elektronische anmutende Unberechenbarkeit, hat man ein ähnlich ausgeklügeltes Musikerlebnis höchstens noch auf dem letzten Album von The Knife vor den Latz geknallt bekommen. Die Sounds malen Bilder im Kopf, denen man sich schon nach wenigen Minuten nicht mehr zu entziehen vermag. Diese Platte flüstert einem mit einem betörenden Grinsen ins Ohr: Komm in meine Welt, du wirst es nicht bereuen. Einmal dort angekommen, gibt es kein Entrinnen mehr aus dieser virtuosen Gruselmär. „Insides“ ist wie das Erzählen von Gespenster-Geschichten am nächtlichen Lagerfeuer. Funkelnd, knisternd, hitzig. Eine Platte voll Gänsehautmusik. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
 Puh, das muss ich jetzt erstmal schlucken.
Puh, das muss ich jetzt erstmal schlucken.  Wenn der liebe Rocko Schamoni hinterher dann einen Film zu seinem Buch „
Wenn der liebe Rocko Schamoni hinterher dann einen Film zu seinem Buch „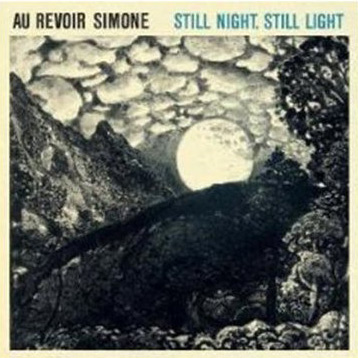 Frühling ist, Maikäfer fliegen. Grashüpfer, ähm, hüpfen.
Frühling ist, Maikäfer fliegen. Grashüpfer, ähm, hüpfen.  Anschließend schauen wir dann mal auf einen Sprung bei
Anschließend schauen wir dann mal auf einen Sprung bei  Und jetzt aber… geht doch! Deutsche HipHop mit Wortspielen hat noch lange nicht ausgedient. Einfach mal
Und jetzt aber… geht doch! Deutsche HipHop mit Wortspielen hat noch lange nicht ausgedient. Einfach mal  Hinterher wagen wir mal einen kleinen Abstecher nach Island. Da solls ja bekanntlich sehr gemütlich zugehen.
Hinterher wagen wir mal einen kleinen Abstecher nach Island. Da solls ja bekanntlich sehr gemütlich zugehen.  Anschließend machen dann
Anschließend machen dann 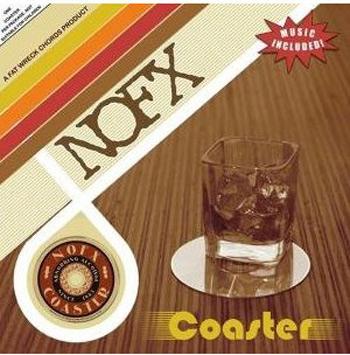 Womit wir schließlich bei „Coaster“ angekommen wären – so heißt das neue Werk aus dem Hause
Womit wir schließlich bei „Coaster“ angekommen wären – so heißt das neue Werk aus dem Hause  Vorher widme ich mich allerdings noch einem weiteren musikalischen Schmankerl aus dem Hause Frank Popp.
Vorher widme ich mich allerdings noch einem weiteren musikalischen Schmankerl aus dem Hause Frank Popp. 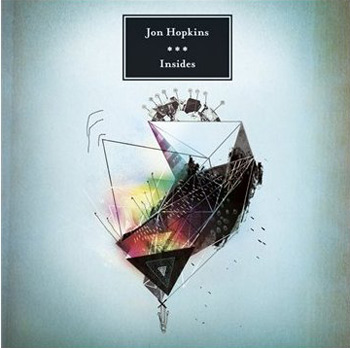 In ganz anderen Gewässern treibt sich das, von flächigen Ambient-Sounds und Pianoklängen eingeleitete, „Insides“ von
In ganz anderen Gewässern treibt sich das, von flächigen Ambient-Sounds und Pianoklängen eingeleitete, „Insides“ von
UND WAS NUN?