 Ob Fans von Vampire Weekend wirklich Gefallen am neuen Album von Thieves And Villains finden werden, wie es der Presse-Sticker verspricht, sei jetzt einmal dahin gestellt, aber alle Fans von Panic At The Disco, The Audition und Fall Out Boy sollten sich „South America“ auf keinen Fall entgehen lassen. Das schicke Artwork lädt bereits zur großen Baggersee-Sause ein und spätestens, wenn man den zähen Opener „16 Hits“ hinter sich gelassen hat, entfaltet sich ein Hit-Reigen, der im Gegensatz zu vielen anderen Emo-Gesellen so luftig arrangiert wurde, dass man sich von der Masse an Melodien nicht gleich erschlagen fühlt. Stattdessen schwirren einem die Hookline von „Drunk In Amsterdam“ und der akustische Rausschmeißer „South Street Hymnal“ noch Stunden später im Kopf herum. Alles in allem sicher kein weltbewegendes, aber durchaus liebenswertes Emo -Pop-Werk für anstehende Sommerpartys.
Ob Fans von Vampire Weekend wirklich Gefallen am neuen Album von Thieves And Villains finden werden, wie es der Presse-Sticker verspricht, sei jetzt einmal dahin gestellt, aber alle Fans von Panic At The Disco, The Audition und Fall Out Boy sollten sich „South America“ auf keinen Fall entgehen lassen. Das schicke Artwork lädt bereits zur großen Baggersee-Sause ein und spätestens, wenn man den zähen Opener „16 Hits“ hinter sich gelassen hat, entfaltet sich ein Hit-Reigen, der im Gegensatz zu vielen anderen Emo-Gesellen so luftig arrangiert wurde, dass man sich von der Masse an Melodien nicht gleich erschlagen fühlt. Stattdessen schwirren einem die Hookline von „Drunk In Amsterdam“ und der akustische Rausschmeißer „South Street Hymnal“ noch Stunden später im Kopf herum. Alles in allem sicher kein weltbewegendes, aber durchaus liebenswertes Emo -Pop-Werk für anstehende Sommerpartys.
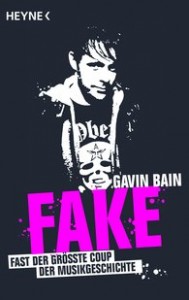 In dem Buch „Fake“ dreht sich derweil alles um ein Duo schottischer Studenten, die mit ihrem Rap-Projekt den großen Reibach machen möchten. Autor Gavin Bain versteht es bisweilen gekonnt, dem Musik-Geschäft einen Spiegel vorzuhalten, wenn er seine Protagonisten fortwährend dazu anleitet, sich für den kommerziellen Erfolg zu verrenken bis letztlich jegliche autobiografische Note aus der Musik verschwunden ist. „Wenn uns als schottische Rapper niemand ernst nimmt, dann versuchen wir es eben als Amis“ gibt Schlaumeier Bill die Richtung vor. Und dann bekommt man eine Geschichte vor den Latz geknallt, die all jene Oberflächlichkeiten durchdekliniert, denen man sich im Reich der Stars und Sternchen eben so ausgeliefert sieht. Dieser Roman handelt vor allem von Exzessen und der Suche nach der eigenen Identität. Der Hinweis am Ende, dass der Autor inzwischen eine neue Band am Start hat, wirkt zwar bisweilen etwas kalkuliert. Alles in allem aber trotzdem eine nette, leicht übertrieben anmutende Sommerlektüre, die vom Leser nicht viel Aufmerksamkeit einfordert, die sich dafür aber schön in einem Rutsch durchschmökern lässt.
In dem Buch „Fake“ dreht sich derweil alles um ein Duo schottischer Studenten, die mit ihrem Rap-Projekt den großen Reibach machen möchten. Autor Gavin Bain versteht es bisweilen gekonnt, dem Musik-Geschäft einen Spiegel vorzuhalten, wenn er seine Protagonisten fortwährend dazu anleitet, sich für den kommerziellen Erfolg zu verrenken bis letztlich jegliche autobiografische Note aus der Musik verschwunden ist. „Wenn uns als schottische Rapper niemand ernst nimmt, dann versuchen wir es eben als Amis“ gibt Schlaumeier Bill die Richtung vor. Und dann bekommt man eine Geschichte vor den Latz geknallt, die all jene Oberflächlichkeiten durchdekliniert, denen man sich im Reich der Stars und Sternchen eben so ausgeliefert sieht. Dieser Roman handelt vor allem von Exzessen und der Suche nach der eigenen Identität. Der Hinweis am Ende, dass der Autor inzwischen eine neue Band am Start hat, wirkt zwar bisweilen etwas kalkuliert. Alles in allem aber trotzdem eine nette, leicht übertrieben anmutende Sommerlektüre, die vom Leser nicht viel Aufmerksamkeit einfordert, die sich dafür aber schön in einem Rutsch durchschmökern lässt.
 Richtig viel Lärm machen hinterher Comeback Kid, die ihr heiß ersehntes, neues Album „Symptoms + Cures“ rauskegeln. Die Scheibe bewegt sich konsequent im Grenzgebiet von Gallows und Konsorten und sorgt so dafür, dass man schon nach wenigen Sekunden die Fäuste gen Firmament reckt. Es gibt derzeit kaum eine Band, die ihre Hardcore-Riff-Attacken so punktgenau ansetzt – im Track „Because Of All“ wird es zwar mal kurz etwas melodiöser Marke Slipknot (ruhigere Abteilung), danach wird aber wieder das Gaspedal durchgetreten und mit Anlauf in die schwitzende Menge gehechtet. Die größte Stärke dieser Band liegt darin, dass sie es schafft, dem Zuhörer das Gefühl zu vermitteln, unmittelbar dabei zu sein. Wie sie es hinkriegen, das Ganze so zielgerichtet auf Platte zu transformieren, bleibt ihr großes Geheimnis. Also Regler hoch und abgehen: „Get Alone!“
Richtig viel Lärm machen hinterher Comeback Kid, die ihr heiß ersehntes, neues Album „Symptoms + Cures“ rauskegeln. Die Scheibe bewegt sich konsequent im Grenzgebiet von Gallows und Konsorten und sorgt so dafür, dass man schon nach wenigen Sekunden die Fäuste gen Firmament reckt. Es gibt derzeit kaum eine Band, die ihre Hardcore-Riff-Attacken so punktgenau ansetzt – im Track „Because Of All“ wird es zwar mal kurz etwas melodiöser Marke Slipknot (ruhigere Abteilung), danach wird aber wieder das Gaspedal durchgetreten und mit Anlauf in die schwitzende Menge gehechtet. Die größte Stärke dieser Band liegt darin, dass sie es schafft, dem Zuhörer das Gefühl zu vermitteln, unmittelbar dabei zu sein. Wie sie es hinkriegen, das Ganze so zielgerichtet auf Platte zu transformieren, bleibt ihr großes Geheimnis. Also Regler hoch und abgehen: „Get Alone!“
 Zum Runterkommen empfiehlt sich hinterher das aktuelle Album von Zola Jesus, einer russisch-stämmigen Sirene, die anmutet, als käme die Protagonistin gerade eben aus einem Opernhaus gehüpft, um ihre himmelhochjauchzenden Melodien mit poppigen Arrangements ad absurdum zu führen. „Stridulum II“ erinnert nicht zufällig an die mysteriösen Sounds von Fever Ray und Bat For Lashes, kommt aber alles in allem nicht ganz so creepy rüber. Die Drum-Phantasien sorgen fortwährend dafür, dass man die Augen schließt und in wundersame Welten abdriftet. Wirkt irgendwie seltsam aus der Zeit gerissen, dieses Werk. So als wollte die Musikerin ihre Hörer ganz bewusst in eine Zwischenwelt entführen.
Zum Runterkommen empfiehlt sich hinterher das aktuelle Album von Zola Jesus, einer russisch-stämmigen Sirene, die anmutet, als käme die Protagonistin gerade eben aus einem Opernhaus gehüpft, um ihre himmelhochjauchzenden Melodien mit poppigen Arrangements ad absurdum zu führen. „Stridulum II“ erinnert nicht zufällig an die mysteriösen Sounds von Fever Ray und Bat For Lashes, kommt aber alles in allem nicht ganz so creepy rüber. Die Drum-Phantasien sorgen fortwährend dafür, dass man die Augen schließt und in wundersame Welten abdriftet. Wirkt irgendwie seltsam aus der Zeit gerissen, dieses Werk. So als wollte die Musikerin ihre Hörer ganz bewusst in eine Zwischenwelt entführen.
 Die Annuals machen sich derweil auf in beschwingte Gefilde und lassen ihre melodiösen Songs einen Salto nach dem anderen schlagen. Freunde von Animal Collective dürften sich bereits nach wenigen Minuten pudelwohl fühlen. Hier allerdings steht im größeren Maße der Pop-Aspekt der Songs im Vordergrund, was so viel heißt, wie: das Zeug kannste auch mal in der Indie-Disco auflegen, ohne dass sich die Hälfte der Gäste fragt, wie man jetzt dazu tanzen soll. „Count The Rings“ ist Bubble-Gum-Pop für Fortgeschrittene. Wer auf die Flaming Lips steht, sollte diesem abgefahrenen Sammelsurium aus B-Seiten und Lieblingssongs einen Durchlauf in der heimischen Stereoanlagen genehmigen. Es dürfte sich lohnen.
Die Annuals machen sich derweil auf in beschwingte Gefilde und lassen ihre melodiösen Songs einen Salto nach dem anderen schlagen. Freunde von Animal Collective dürften sich bereits nach wenigen Minuten pudelwohl fühlen. Hier allerdings steht im größeren Maße der Pop-Aspekt der Songs im Vordergrund, was so viel heißt, wie: das Zeug kannste auch mal in der Indie-Disco auflegen, ohne dass sich die Hälfte der Gäste fragt, wie man jetzt dazu tanzen soll. „Count The Rings“ ist Bubble-Gum-Pop für Fortgeschrittene. Wer auf die Flaming Lips steht, sollte diesem abgefahrenen Sammelsurium aus B-Seiten und Lieblingssongs einen Durchlauf in der heimischen Stereoanlagen genehmigen. Es dürfte sich lohnen.
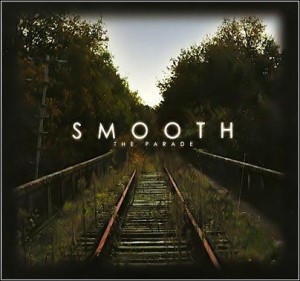 Smooth lässt es hinterher die gleichnamige Combo aus Nantes angehen, die sich auf „The Parade“ daran versucht, die epischen Anleihen von The Verve mit einer distanzierten Haltung zu vermengen. Unterstützt von zahlreichen Gast-Stars, wie Dominique A und Amélie entsteht daraus ein vielseitiges Album, dessen reservierte Haltung allerdings zwischenzeitlich auch mal etwas Geduld einfordert, wenn Songs mit einem ausgiebigen Intro ausgestattet werden, um den Hörer darauf einzustimmen, was da noch kommen mag. Wer mal wieder in anderen Sphären schwelgen möchte, sollte sich das Teil genüsslich in der Hängematte zu Gemüte führen.
Smooth lässt es hinterher die gleichnamige Combo aus Nantes angehen, die sich auf „The Parade“ daran versucht, die epischen Anleihen von The Verve mit einer distanzierten Haltung zu vermengen. Unterstützt von zahlreichen Gast-Stars, wie Dominique A und Amélie entsteht daraus ein vielseitiges Album, dessen reservierte Haltung allerdings zwischenzeitlich auch mal etwas Geduld einfordert, wenn Songs mit einem ausgiebigen Intro ausgestattet werden, um den Hörer darauf einzustimmen, was da noch kommen mag. Wer mal wieder in anderen Sphären schwelgen möchte, sollte sich das Teil genüsslich in der Hängematte zu Gemüte führen.
 Aufs Wesentliche beschränken sich auch die Lo-Fi-Popper von Summer Camp auf ihrer aktuellen EP „Young“. Mit sechs schmissigen Stücken, die jedem Fan von Bombay Bicycle Club bis Magnetic Fields das Herz öffnen, schubsen sie einen zurück in die 80er und sorgen mit der alles überstrahlenden Hit-Single „Was It Worth It“ für Freudentränen bei all jenen, die noch mal ihren eigenen Abschlussball revivaln möchten. Wenn das Londoner Duo es schafft, diese Unbekümmertheit auch auf Albumlänge zu transformieren, dürfte es bald über die Szene-Blogs hinaus für Aufsehen sorgen.
Aufs Wesentliche beschränken sich auch die Lo-Fi-Popper von Summer Camp auf ihrer aktuellen EP „Young“. Mit sechs schmissigen Stücken, die jedem Fan von Bombay Bicycle Club bis Magnetic Fields das Herz öffnen, schubsen sie einen zurück in die 80er und sorgen mit der alles überstrahlenden Hit-Single „Was It Worth It“ für Freudentränen bei all jenen, die noch mal ihren eigenen Abschlussball revivaln möchten. Wenn das Londoner Duo es schafft, diese Unbekümmertheit auch auf Albumlänge zu transformieren, dürfte es bald über die Szene-Blogs hinaus für Aufsehen sorgen.
 Die Casiokids führen einem derweil eindrucksvoll vor Augen, wie man in norwegischer Mundart die Welt erobert. Schon der Opener ihres Albums „Topp Stemning Pa Lokal Bar“ klingt, als hätten sich The Whitest Boy Alive mit Hot Chip vermählt. Die restlichen sieben Songs peppen Indie-Pop der Marke Phoenix mit Techno-, und Afro-Beat-Anleihen auf und weil das Ganze so ruckizucki durchgeleiert ist, drückt man ebenso hurtig die „Repeat“-Taste, um sich mit diesem kurzweiligen Sommer-Pop noch mal ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Dementsprechend… genießt die Sommersonne (wenn sie denn kommt). Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Die Casiokids führen einem derweil eindrucksvoll vor Augen, wie man in norwegischer Mundart die Welt erobert. Schon der Opener ihres Albums „Topp Stemning Pa Lokal Bar“ klingt, als hätten sich The Whitest Boy Alive mit Hot Chip vermählt. Die restlichen sieben Songs peppen Indie-Pop der Marke Phoenix mit Techno-, und Afro-Beat-Anleihen auf und weil das Ganze so ruckizucki durchgeleiert ist, drückt man ebenso hurtig die „Repeat“-Taste, um sich mit diesem kurzweiligen Sommer-Pop noch mal ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Dementsprechend… genießt die Sommersonne (wenn sie denn kommt). Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?