Der allseits beliebte Beirut scheint immer noch nicht genug vom Weltenbummeln zu haben. Jedenfalls hat er sich auf seinem dritten Album gleich zwei Länder vorgenommen, denen er sein musikalisches Korsett über streift. Auf „March Of The Zapotec And Realpeople Holland“ spaziert er fröhlich durch Mexiko und die Niederlande und zeichnet seine Impressionen auf. Dass die erste Hälfte der Scheibe ursprünglich für ein Filmprojekt gedacht war: Sei´s drum. Die Scheibe funktioniert gerade aufgrund ihrer inneren Zerrissenheit und des offensichtlichen Gegensatzes ganz wunderbar. Auf Seite eins prosten einem Trompete, Tuba und Ukulele zu, als ob es kein morgen gäbe. Subtiler Gypsie-Indie kann so schön sein. Da möchte man fast schon Walzer zu tanzen, würde man nicht plötzlich von einem futuristischen Roboter überrannt, der genau dort ansetzt, wo Conor Oberst einst auf „Digital Ash in A Digital Urn“ eine glimpfliche Bruchlandung hinlegte. Die 80er haben auf der „Holland“ Seite jedenfalls einen bleibenden Eindruck hinterlassen, was wiederum den Schluss zulässt, dass sich Zach Condon auch hin und wieder den eigenen Vorstellung hingibt, wie seine Welt denn nun klingen sollte. In seiner Musik geht es um Visionen. Seine Songs sind wie Schnappschüsse, die immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit erfassen. Und in dieser Hinsicht zumindest imposant umgesetzt. Bleibt abzuwarten, was er sich wohl als nächstes unter den Nagel reißt. Island wäre doch mal was. Da könnte er seinen Hang zum Theatralischen voll ausleben.
Bis dahin allerdings lassen wir uns noch eine Runde von der aktuellen B-Seiten Kollektion aus dem Hause Danko Jones in den Luftgitarrenhimmel beamen. Schon der Auftakt in Form der bretternden Breitseite „The Rules“ hievt dich auf das nächste Podest von dem aus du der Welt deine lang erprobten Posen fürs nächste Guitar Hero Match präsentierst. Und wie jetzt? Du meinst, die will ja eh keiner sehen. Macht doch nichts. Geht doch sowieso nur um den Spaß an der Sache und Spaß macht die Scheibe, wie kaum eine andere. Das Gaspedal wird gleich zu Beginn voll durch getreten und versetzt dir in den folgenden 71 Minuten auf 27 Tracks allerhand Adrenalinstöße, bis du die Karre schließlich über den nächsten Abhang jagst. Abschnallen brauchst du dich nicht mehr, weil der Gurt eh schon gerissen ist, also schnell das Schiebedach nach hinten kurbeln und sich aus der frei fliegenden Karre ins kühle Nass hechten, dass sich da vor deinem feuerroten Auge ausbreitet. Kurz nachdem du dann in die eiskalte Brühe eintauchst, merkst du allerdings, dass du deine warmen Klamotten heute nicht übergestreift hast. Aber macht ja nichts. Danko Jones schlagen auch die schlimmste Eiszeit zurück. Also dreimal laut „My Problems (Are Your Problems Now)“ ins kühle Nass gebrüllt und die Eiszapfen um dich herum verwandeln sich in Heizkristalle (Wortneuschöpfung, Baby!). Anschließend dann noch schnell an die Flosse des nächsten Hais gehängt und mit gereckter Faust und einem lauten „Hey, hey“ auf den Lippen in Richtung Sonnenuntergang reiten. So schön kann traditionelle Rockmusik sein. Fehlt jetzt eigentlich nur noch eine passende Dröhnung verzerrter Indie-Slackerness, um das ganze gekonnt ad absurdum zu führen.
Am besten du schmeißt dazu das neue Album von Sky Larkin in den Player. Das Trio aus Leeds schnorchelt auf seinem Debüt ziemlich effektiv in Gefilde, wo sich Sleater-Kinney & die Long Blondes zum Strandurlaub treffen. Von dort aus wird dann so fröhlich verquer herum gebrüllt, dass man meint, sie wollten den Los Campesinos! den Rang als euphorischste Jungspunde der Gegenwart ablaufen. Dabei ist „The Golden Spike“ eigentlich ein ziemlich Langschläfer gewesen. Die Band existiert nämlich schon seit 2005, sah sich aber bisher nicht genötigt, mehr als nur ein paar famose Singles raus zu hauen. Umso schöner zu sehen, dass die zwölf Tracks auf ihrem Debüt so unbeschwert vor sich hinlaufen, als hätten sie das Ganze mal eben spontan aus der Hüfte geschossen. Erschöpfungszustände sucht man auf „The Golden Spike“ jedenfalls vergebens. Wodurch der britische Blätterwald auch schon ordentlich die Werbetrommel für sie rührt. Ob sie das ganze Tuscheln und einen sich anbahnenden MTV-Hit heil überstehen? Beim nächsten Album wissen wirs. Bis dahin vertreiben wir uns ein bisschen die Zeit mit Kopfnicken.
Einer der besten seines Fachs ist zurück und präsentiert auf „Beat Konducta Vol. 5 & 6“ einen weiteren imposanten Einblick in seine „Raw Tapes“. Dabei ist es immer wieder bezaubernd den soul-beeinflussten Tunes von Madlib zu lauschen. 42 sind es diesmal an der Zahl und dennoch wirkt die Scheibe zu keinem Zeitpunkt zerrissen oder droht ihren Groove zu verlieren. Stattdessen dreht man die Scheiben des Wagens runter und freut sich über einen der vielleicht besten Outputs der Post (oder Prä?) –Dilla Ära. Wie lange der Junge wohl gebraucht hat, um aus seinem Sammelsurium an Vinylscheiben diese zahllosen Knaller zu absorbieren? Darüber kann man letztlich nur philosophieren. In jedem Fall ist das nun neu aufgelegte Ergebnis, wie schon die beiden Updates der Vorgänger, alle Mühe wert gewesen.
Etwas fragwürdiger mutet das neue Album von Ben Kweller an, wenn es in bester Western-Manier erstmal den Cowboy um die Ecke in den Salon bittet. So richtig warm jedenfalls werde ich auch nach zahlreichen Durchläufen nicht mit „Changing Horses“. Der Stallgeruch der Songs wirkt zwar zwischenzeitlich sehr –sagen wir erfrischend-, wenn er in „Old Hat“ mal den Melancholiker raus lässt. Aber wenn er dann in „Fight“ vollends in musikalischen Klischees ersäuft, wird man fast zwangsläufig dazu genötigt, die Skip Taste in ihre Furchen zu pressen. Alles in allem muss ich – bei allem Respekt vor diesem durchaus wunderbaren Künstler – in diesem Fall leider passen. Vielleicht fehlt mir zu diesem Album auch einfach der Zugang, weil Country eben nicht, wie in Kwellers Fall mein „Soundtrack Of My Life“ ist. Schade eigentlich. Aber das nächste Mal hat er sich sicher schon wieder einen neuen Stil vorgeknöpft. Und dann können wir auch wieder Freunde werden. Solche Alben sollten ja am Ende nur dazu beitragen, dass sich das Band weiter festigt, wenn man sich zum nächsten Mal trifft.
„Was wollt ihr alle auf dem Dänsfloar“ fragt sich dann hinterher Robert Drakogiannakis alias Tante Angelika alias ihr ahnt es… Angelika Express. Die sind nämlich kurzerhand reanimiert worden und zerren auch gleich noch den Drive aus dem Schlamm, den sie im Neonlicht des Projekts Planetakis schon verloren zu haben schienen. „Goldener Trash“ jedenfalls schließt über weite Strecken nahtlos an die großen Momente der Frühphase an. Natürlich wurde das schicke alte Kleid ein bisschen glatt gebügelt, aber ansonsten ist man nur allzu gern bereit sich diesem Ringelreihtänzchen aus indielastiger Raffinesse hinzugeben. Nur noch schnell den öden Pulli abgestreift und dann laut im Chor: „Mach die Augen zu und denk an Goldenen Trash, and everything you want to smash“. Rumms, zack, krach. Genau so muss ein Angelika Express Song losgehen. „Dich gibt´s nicht“ ist genau die Hymne, die sich alle von der großen Liebe Träumenden in großen Lettern auf die Popacken tätowieren möchten, um damit zu demonstrieren, dass einem alles andere völlig am Arsch vorbei geht. Idealbilder sind eben was Wunderbares. Dieses Album ist auch ein Solches. Anschmiegsamkeiten an den Mainstream, wie sie noch am Ehesten in „Du trinkst zu viel“ um die Ecke wanken, werden kurzerhand hinweggefegt von der wieder gefunden Spielfreude des Krawatten tragenden Stimmungsmachers aus Kölle. Karneval zerschmettern mit der Glam Keule von T-Rex. In die Menge rotzen zum Sound der Sex Pistols. Angelika Express wühlen in der Klamottenkiste des Pop und bedienen sich fröhlich an den Outfits. Dass sie damit das Rad der Popmusik nicht neu erfinden. Keine Frage. Aber Spaß macht das Teil wie Hölle. Für den Moment die vielleicht schönste Zitatkanone des Frühlings. Also Zippo auf und ab dafür. Und hinterher dann mal die neue Seeed auf den Plattenspieler gestülpt. Und wie jetzt? Seeed haben gar nix Neues am Start? Oh, jetzt merk ich’s auch.
Denn spätestens wenn der Gesang einsetzt wird der tanzbare Beat, der sich da in den Sound von School Of Seven Bells geschlichen hat, komplett ad absurdum geführt. Klingt dann irgendwie fast weltmusikalisch. Ebenso zeitlos, wie hoffnungslos hip. Doch je mehr Soundschichten sich anschließend übereinander stapeln, umso mehr bekommt man das Gefühl hier einem echten Herzensbrecher zu erliegen. „Alpinisms“ kombiniert das Beste aus verstrahlten psychedelischen Ansätzen, zeitgemäßen Beats und einem verzaubernden Gesang, dass noch am ehesten mit dem von Karin Dreijer Andersson (Fever Ray, The Knife) zu vergleichen wäre. Daraus entspringt eine ziemlich geglückte Hommage an die alles überdeckenden My Bloody Valentine gepaart mit einer gehörigen Portion epischer Facetten. Überall scheint irgendetwas zu zwitschern, klackern oder fiepen. Dennoch funktionieren die Tracks auch abseits der elektronischen Spielereien. „Half Asleep“ zum Beispiel schimmert unter der Oberfläche einfach nur wie ein sternenklarer Popsong, der einfach so vom Himmelszelt purzelt. Manche haben das dann auch tatsächlich schon mit Alanis Morissette verglichen. Ist auch gar nicht mal so abwegig. Sagen wir mal in Richtung zweites Album, wo sie sich an so herrlichen Experimenten austobte… dann ist die Distanz gar nicht mehr so groß. Alles in allem auf jeden Fall ein beglückendes Soundexperiment der zeitgemäßen Drone-Pop-Gattung, das man sich am besten nach einer durch geknallten Party über Kopfhörer reinzieht.
Vorher hat man sich ja eh schon den ganzen Abend mit The Rifles und Konsorten herum geschlagen. Und zugegeben: Der Popappeal des neusten Werkes ist mal wieder bestechend. Wie schon auf dem hierzulande leider schmerzlich verschmähten Erstling reiht sich auf „The Great Escape“ Hit an Hit für die Post-Kaiser Chiefs-Fraktion. Doch ganz im Gegensatz zur Schlagerindie-Glückseeligkeit aus Leeds, wirken die Rifles noch so frisch und motiviert, dass man kurzerhand sein geistiges Gegenüber an die Hände nimmt und fröhlich durchs Zimmer schleudert. Tanzen ist alles was man möchte, wenn betörende Hits, wie „Sometimes“ oder der Opener „Science In Violence“ auf einen losstampfen. Und auch wenn die erste Single „The Great Escape“ auf den ersten Eindruck etwas fahl schmeckt: der Rest der Scheibe entpuppt sich als perfektes Textblatt für Indie-Disco-Schreihälse. Hier steuert eine Band ganz konsequent auf den großen Herzensbrecherrefrain zu. Und man ertappt sich immer wieder dabei, wie man die Melodien mit einem Grinsen im Gesicht stundenlang vor sich hinträllert. Solltet ihr also noch das letzte Album der Wombats wie einen Schatz in euren Händen wiegen und dabei Kopfstände im Bett vollziehen. Hier ist der perfekte Soundtrack für die nächste Sprungrolle mit Handstand-Überschlag.
Bei Reel Big Fish fragt man sich dann hinterher aber schon ein bisschen, wen sie mit der x-ten Auflage eines Punkrocker spielen Rockklassiker Albums noch aus der Reserve locken möchten. „Talk Dirty To Me“ von Poison oder die unsäglichen Eagles. Zumindest in Sachen schlechter Geschmack haben sie dann auch covertechnisch die Nase vorn. Ich meine hey, das zollt einem schon fast Respekt ab mit welcher Hingabe sie auf „Fame, Fortune And Fornication“ den 80er frönen. Würde man sich nicht zwischenzeitlich in Grund und Boden schämen für diesen unsäglichen Versuch einen auf Me First And The Gimme Gimmes mit Schunkel Garantie zu machen, bleibt nur der letzten Rettungsanker namens: „Brown Eyed Girl“. Den kriegen auch Reel Big Fish nicht klein (wobei ich hier noch mal anmerken möchte, dass ich zu alten „Beer“-Zeiten mal ein großer Fan dieser Band gewesen bin). Dieses Album jedenfalls gehört weggesperrt und erst wieder in Freiheit entlassen, wenn man nachts um drei auf einer nervtötenden Party eine Kuschelrock-Scheibe mit ein paar Ska-Covers kontern möchte. Dann wiederum entfalten die Songs fast schon so etwas, wie Charme. Aber was heißt das schon?
Ich halte mich dann doch lieber an die ziemlich wunderbaren Nickel Eye. Die klingen vorwiegend so, als hätten die Strokes noch mal die Chance gehabt ihr zweites Album einzuspielen und wären nicht so grandios gescheitert. Schlicht erhaben wirken diese von den Kinks bis hin zu Leonard Cohen inspirierten Songs, dass man sich im Minutentakt entweder unter der Decke verkriechen möchte oder fröhlich mit dem Tanzbein schwingt. So abwesend, wie sich Strokes Bassist Nikolai Fraiture mit lieben Bekannten, wie Regina Spektor und Nick Zimmer von den Yeah Yeah Yeahs hier durch die Songs nölt. Da braucht er den Vergleich mit seiner Hauptband wirklich nicht zu scheuen. Vor allem, weil sich „The Time Of The Assassins“ nicht darin erschöpft, immer wieder denselben Song zu spielen. Nein, hier wird das ganze Spektrum moderner Gitarrenmusik mit einem Hang zur tanzbaren Melancholie ausgelotet. Ein durchaus überraschender Sidekick also, mit dem einem der liebe Nikolai hier Feuer unterm Arsch macht. Und absolut perfekt dazu geeignet demnächst im Duett mit Hayden die Lautsprecherboxen deiner Anlage für sich zu vereinnahmen.
Dieser Hayden nämlich, dessen Nachname Desser lautet, hat klammheimliche fünf Alben geschrieben. Das aktuellste namens „In Field & Town“ schafft es nun endlich auch zu uns nach Europa. Mit seinem Hang zum verkratzten Falsetto klingt er dabei wie ein Zwitter aus Neil Young und Leonard Cohen. Die erst kürzlich absolvierten Support-Slots für Miss Feist und The National dürften dabei nicht ganz zu Unrecht dazu beitragen, dass sich seine verfolkten Klänge nun schon bald in den Ohren des Mainstream Publikums verfangen könnten. Fehlt eigentlich nur noch eine passende Platzierung in einer allseits beliebten Vorabend-Soap und schon würde es steil nach oben gehen. Da ist es nur umso schöner zu sehen, dass sich Hayden dem Ganzen Business-Ding bisher ganz gezielt verweigert. Stattdessen schreibt er lieber einen tollen Track für das hierzulande verschmähte Regiedebüt des wunderbaren Schauspielers Steve Buscemi. Und hält sich ganz bewusst im Dickicht versteckt, wo ihn die Massen nicht direkt vor die Linse bekommen. Das Magazin „Mojo“ findet das dann „Superior“. Die „Alternative Press“ ist zu Tränen gerührt. Und mir wird auch schon ganz warm ums Herz. Also lasst euch bezaubern. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
P.S. Ach so, einen haben wir noch bevor wir dann mit großen Schritten auf die 50 zugehen. Das aktuelle Tune von den Crystal Antlers soll hier nämlich keinesfalls unterschlagen werden. Die Band sollte eigentlich am 11. Februar im Würzburger Immerhin auftreten, ist aber leider wieder aus den Analen der Club-Homepage verschwunden. Aber auch, wenn wir auf das berauschende Live-Ereignis erstmal verzichten müssen. Ihre Debüt EP klingt so dermaßen verzückend nach Popband, die sich im Postrock-Labyrinth verläuft, dass man ihnen auf der Stelle zu Füßen liegt. Absoluter Höhepunkt ist dabei sicherlich das süßlich-dronige „A Thousand Eyes“, dass wie alle anderen Songs ihrer EP von Mars Volta Keyboarder Ikey Owens in Szene gesetzt wurde. Am Ende ist man schlicht hingerissen von diesem verqueren Psychedelic-Soul-Post Hardcore-Garage-Mix, der sich da aus den Boxen schält, dass man sich für immer hinter den schützenden Wänden der übergroßen Kopfhörer verstecken möchte. Die nämlich eignen sich geradezu vortrefflich dazu, die Musik in all ihren Facetten zu genießen. Also dann… Bis zum 50ten. Wir lesen uns.
//alexander nickel-hopfengart
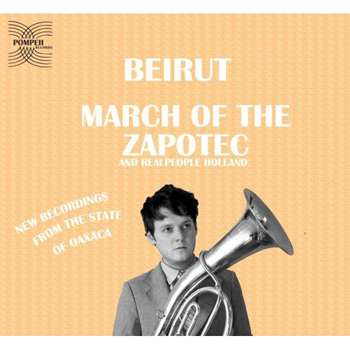 Der allseits beliebte
Der allseits beliebte  Bis dahin allerdings lassen wir uns noch eine Runde von der aktuellen B-Seiten Kollektion aus dem Hause
Bis dahin allerdings lassen wir uns noch eine Runde von der aktuellen B-Seiten Kollektion aus dem Hause  Am besten du schmeißt dazu das neue Album von
Am besten du schmeißt dazu das neue Album von  Einer der besten seines Fachs ist zurück und präsentiert auf „Beat Konducta Vol. 5 & 6“ einen weiteren imposanten Einblick in seine „Raw Tapes“. Dabei ist es immer wieder bezaubernd den soul-beeinflussten Tunes von
Einer der besten seines Fachs ist zurück und präsentiert auf „Beat Konducta Vol. 5 & 6“ einen weiteren imposanten Einblick in seine „Raw Tapes“. Dabei ist es immer wieder bezaubernd den soul-beeinflussten Tunes von 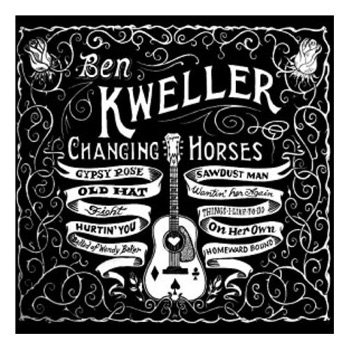 Etwas fragwürdiger mutet das neue Album von
Etwas fragwürdiger mutet das neue Album von  „Was wollt ihr alle auf dem Dänsfloar“ fragt sich dann hinterher Robert Drakogiannakis alias Tante Angelika alias ihr ahnt es…
„Was wollt ihr alle auf dem Dänsfloar“ fragt sich dann hinterher Robert Drakogiannakis alias Tante Angelika alias ihr ahnt es… 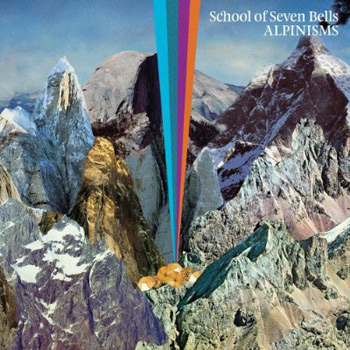 Denn spätestens wenn der Gesang einsetzt wird der tanzbare Beat, der sich da in den Sound von
Denn spätestens wenn der Gesang einsetzt wird der tanzbare Beat, der sich da in den Sound von 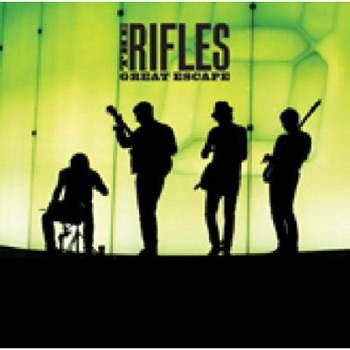 Vorher hat man sich ja eh schon den ganzen Abend mit
Vorher hat man sich ja eh schon den ganzen Abend mit  Bei
Bei 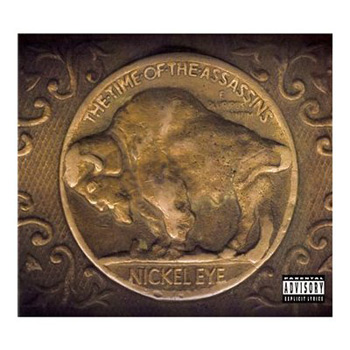 Ich halte mich dann doch lieber an die ziemlich wunderbaren
Ich halte mich dann doch lieber an die ziemlich wunderbaren 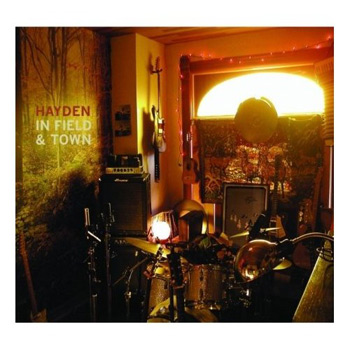 Dieser
Dieser  P.S. Ach so, einen haben wir noch bevor wir dann mit großen Schritten auf die 50 zugehen. Das aktuelle Tune von den
P.S. Ach so, einen haben wir noch bevor wir dann mit großen Schritten auf die 50 zugehen. Das aktuelle Tune von den
UND WAS NUN?