Vor kurzem wurde in einer großen Tageszeitung darauf hingewiesen, dass sich Popmusik im Gegensatz zu Rockmusik dem ständigen Wandel der Zeit anzupassen habe. Man kann also sagen, dass die Rolling Stones im Gegensatz zu Madonna von der Nostalgie profitieren, die ihrer Musik inne wohnt. Die Popmusik allerdings im Hier und Jetzt verankert ist und sich dadurch immer wieder aufs Neue beweisen muss. Das alles mag in gewisser Hinsicht richtig sein, denn sieht man sich ein Konzert von -sagen wir mal- Britney Spears anno 09 an, dann fällt auf, dass dort so gut wie keine alten Songs mehr im Programm sind – und wenn doch höchstens als Remix im aktuellen Gewand. Was das wiederum für das neue Album der Pet Shop Boys bedeutet, sollte letztlich klar sein: „Yes“ – als Popalbum, das es zweifelsohne ist – hat sich gefälligst dem Zeitgeist anzupassen. Und auf den ersten Blick tut es das auch. Wurde doch niemand Geringeres als Xenomania (aka Brian Higgins / verantwortlich für unzählige Alben und Songs von den Sugababes, Girls Aloud und Kylie Minogue) angekarrt, um die Jungs auf die vorderen Plätze in Sachen Trendcharts zu hieven. Nun allerdings haben die Pet Shop Boys trotzdem ein Album aufgenommen, das eben vor allem eins ist: ein Pet Shop Boys-Record. Kleine, aber feine Hits, wie die erste Single „Love etc.“ und „All Over The World“, sind subtile Perlen, die im Formatradio nicht groß auffallen und gerade daraus ihren größten Nutzen ziehen. Soll heißen: sie nerven nicht – auch nicht beim hundertsten Durchlauf. Was ja bei den Pet Shop Boys irgendwie schon immer so war. Genervt hat vielleicht höchstens noch ihr bis dato größte Hit „Go West“, was wiederum dafür spricht, dass sich diese Band in diesem einen Fall, wo sie sich dem Zeitgeist unterordnete, von Selbigem übermannt wurde. In den meisten Fällen wirken ihre Songs aber wie Silhouetten. Wie Schaulustige am Wegesrand der Popmusik. Man muss sich nur mal ihr famoses Best Of-Werk „PopArt“ zu Gemüte führen. Das läuft geradezu über vor Hits, die man aber gerade eben nicht über hat. Ähnlich verhält sich die Sache mit „Yes“. Die Pet Shop Boys bleiben die liebenswerte Popband von Nebenan, die auch der Indie-Hörer gerne hat, weil sie der Kunst willen darauf verzichtet, sich irgendwie anzubiedern. Soll heißen: „Yes“ ist zeitlos. Und es wirkt fast so, als wären die Pet Shop Boys so etwas, wie die ultimative Pop-Band. Dass sie dabei nicht Gefahr laufen, sich abzunutzen, ist ihr größtes Kapital. Die Pet Shop Boys sind nicht U2 oder die Rolling Stones, deren neue Alben sich alle in den Schrank stellen, aber trotzdem keiner anhört. Die Band stellt vielmehr unter Beweis, dass es auch einer Popband möglich ist, Songs zu schreiben, die Bestand haben. „Yes“ ist ein Album, das man auch in einigen Jahren noch gerne auflegen wird. Nicht aus Nostalgiegründen und schon gar nicht aus Gründen des Zeitgeistes. Nein, einfach nur, weil die Musik eine sanfte Wärme ausstrahlt – so als wollte sie sagen: hier bist du zuhause.
Mastodon wiederum profitieren derweil von eben jenem Zeitgeist, den die Pet Shop Boys so gerne ausklammern. In gewisser Weise reitet die Band nämlich auf der erneut aufgeschwappten Welle called Progrock. Die Gruppe huldigt Bands, wie Led Zeppelin, Pink Floyd und King Crimson und die Jungs wissen genau, was sie wollen. „Crack The Skye“ ist ein Album, das scheinbar leichtfüßig über das Seil hüpft, das zwischen den Polen Thin Lizzy, Neurosis und den Melvins aufgespannt ist. Im Gegensatz zum Vorgänger wird diesmal weniger (bis fast gar nicht) geschrieen, was der Band völlig neue Käuferschichten bescheren wird. Hier geht’s aber gerade nicht um den schnellen Hit, den großen Erfolg und um Breitenwirksamkeit. Hier geht’s um ein Konzept – um die Vision einer Band auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. In sieben epischen Songs dreht sich alles um das Verlassen des Körpers, das Durchdringen des Weltraums, um Geister, um eine russische Sekte und um Rasputin. All das spitzt sich zu, zu einem famosen Finale im Dunstkreis der Hölle. Soll heißen: inhaltlich geht’s hier ziemlich fantastisch zu. Und fantastisch ist auch die Musik, die sich anfühlt, wie eine Wasserrutsche mit Looping und Schraube. Ständig ringt man nach Luft. Wird durchgeschüttelt, gen Abgrund geschleudert und wieder empor gehievt. Am Ende weiß man gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist – nur, dass es verdammt viel Spaß gemacht hat. Und das ist das Wichtigste an diesem Album: es macht Spaß. Unabhängig von dem Überbau und der verzwickten Story. Die Songs stehen für sich allein. Beste Vorraussetzungen also für Mastodon endlich aus dem Schatten ins Licht zu treten. Mit diesem Album scheint es nur eine Frage der Zeit, bis sie in Zeiten von schnelllebigen Trends als Gegenentwurf zum Konsumgut mp3 herhalten müssen. Mastodon bieten Nachhaltigkeit. Und genau deswegen wird ihnen die Zeit auch Recht geben… soll heißen: sie werden die Schwelle zum Erfolg bald überschreiten und das ist verdammt noch mal gut so.
Samy Deluxe wiederum, der wohl neben Dendemann beste Reimer des Landes, bekommt mit zunehmender Karrieredauer immer öfter Gegenwind zu spüren. In aggroganten Zeiten ist es eben relativ schwer, mit Wortspielen und Punchlines zu punkten – zumindest verkaufstechnisch. Also wurde erst vor kurzem sein Label „Deluxe Records“ geschrumpft, heißt: um einige Reimer erleichtert. Es ist eben immer das Gleiche: jemand, der aneckt, eignet sich heutzutage einfach besser zum Elternschreck. Da kannst du noch so tolle Wortspiele einbauen. Am Ende siegt eben doch die plumpe Geste im kurzlebigen Popgeschäft. Samy macht nun aus diesem Umstand eine Tugend und lehnt sich einfach mal zurück. Beweisen braucht er eh niemanden mehr was, also wird auf „Dis wo ich herkomm“ auch mal gesungen. Samy packt die Hängematte aus und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. „Diss-Tracks“ sucht man mit wenigen Ausnahmen vergebens. Stattdessen werden Geschichten erzählt. Schöne, traurige und auch mal nervige Themen kämpfen um die Vorherrschaft. Dieses ständige „Deutschland – meine Heimat“-Getue ist ja nicht erst seit Mia. vollkommen ausgelutscht. Gott sei dank sind hier aber auch andere Tracks drauf. Mancher Fan von früher wird anmerken, dass Samy etwas öfter seine Skills unter Beweis stellen könnte. Der Hamburger will mit diesem Album aber lieber Pop machen. Hört man sich „Bis die Sonne rauskommt“ an, ist das ein wahrer Glücksfall für die deutsche Popszene. Der Song strahlt eine solch beschwingte Atmosphäre aus, dass er sich vielleicht mal wieder mit Jan Delay ins Studio verziehen sollte. Zusammen könnten sie dann die Badestrand-Saison ausrufen. Kurz gesagt: ich mag dieses Album. Und das mit der „Competition“ kann er ja auch beim nächsten Mal noch nachholen. Jetzt ist Strandparty. Sonne, ich komme!
Wem das alles eine Spur zu poppig ist, dem sei hier ein Output der progressiven Gangart empfohlen. Long Distance Calling läuten mit ihrem sechsteiligen Epos „Avoid The Light“ den Weltuntergang ein. Das musikalische Endzeitszenario klingt wie eine gelungene Alternative zu Dredg, das -mit Ausnahme eines Gastspiels von Sänger Jonas Renske bei „The Nearing Grave“- ohne den Einsatz von Vocals auskommt. Das instrumentale Gewand verschafft der Musik Freiräume, um das dynamische Auf und Ab der Gitarren ins Blickfeld des Hörers zu hieven. Die sieben- bis dreizehnminütigen Tracks klingen wie ein schwereloser Gleitflug durch Felsenformationen. Der Hörer fühlt sich als stiller Beobachter, muss aber immer wieder einzelnen Gipfeln ausweichen, die da aus dem Dickicht schießen, wie Hoppelhäschen. So wälzt sich im Opener nach neun Minuten eine brachiale Gitarre über die betörende Hoffnungslosigkeit und walzt alles platt, was nicht schnell genug auf den Schleudersitz drückt. Anschließend wird man dann brachial durch die Luft geschleudert, hinterher aber sanft von den Schwingen der Musik in Richtung Horizont verfrachtet. Kurt Ebelhäuser (Blackmail, Donots), der hier als Produzent tätig war, hat ganze Arbeit geleistet. Für Long Distance Calling dürfte dieses Album den lange erhofften Durchbruch bedeuten. Zumindest musikalisch. Einmal infiziert, kann man dieser emotionalen Wucht nämlich nicht mehr entkommen.
Wem das alles eine Spur zu schnell geht, wer sich lieber mal in die Hängematte schmeißt und die Sonne genießt, der könnte mit der schönsten Versuchung seit den Smiths warm werden. Cats On Fire klingen wie die beschwingten Kinder von Morrisseys Gnaden. Die Songs schreien geradezu nach Sommersonne und dürften auch dem letzten Schwerenöter ein sanftes Fußwippen abringen. Was Mattias Björkas (Gesang, akustische Gitarre), Ville Hopponen (elektrische Gitarre), Kenneth Höglund (Bass) und Henry Ojala (Schlagzeug) da auf „Our Temperance Movement“ zusammen schrauben, lässt alle Fans von Belle & Sebastian Kopfüberschläge hinlegen und Frühlingswiesen hinab rollen. Ein Blumenregen aus romantischen Sounds regnet herab – mal balladesk, mal putzmunter entfalten die Songs schon nach einem Durchlauf einen betörenden Charme. Man kommt gar nicht mehr los von der Platte. Man klebt an ihr, wie Glitzersterne im Stickeralbum. Was diese finnische Band hier über 35 Minuten abliefert, man möchte es vor der ganzen Welt verstecken. Man möchte die Musik ganz für sich allein haben. Als hätte man gerade eine alte Truhe geöffnet und etwas einfach nur Liebenswertes gefunden. Cats On Fire. Euch geb ich nicht mehr.
Hinterher verabreichen wir uns dann mal wieder eine echte Breitseite mit der Punkrockkeule. Mit Topfschlagen braucht man den The Riverboat Gamblers gar nicht erst zu kommen. Die wollen gleich den Club in Schutt und Asche legen. Die Songs sind dermaßen hymnisch, dass erst gar keine Zweifel aufkommen. „Underneath The Owl“ ist ein Album, das einem den Brustkorb öffnet, um sich direkt ins Herz des Hörers zu spielen. Ein einziges Feuerwerk an Hits der Marke Rise Against meets The Gaslight Anthem, bis sich alle zu den Songs schweißüberströmt im Arm liegen. Einzelne Hits hervorzuheben macht einfach keinen Sinn. Die 11 Tracks stürmen los. Ready Steady Go! Und ehe man sich versieht, sind sie auch schon am Ziel. Der Hörer liegt ihnen zu Füßen und schreit beschwipst vor Euphorie die Textzeilen gen Clubhimmel. „Underneath The Owl“ ist das bisher imposanteste Punkrockwerk des noch so jungen Jahres. Es würde mich nicht wundern, wenn die Scheibe Ende des Jahres bei vielen Menschen in den Jahrescharts ganz oben steht. Unbedingt mal Anchecken. Es lohnt sich.
Ebenfalls lohnenswert gerät der neuste Wurf aus dem Hause Crystal Antlers. Die werfen nämlich ihre Tentakeln aus und frönen auf dem ebenso betitelten „Tentacles“ dem verrauschten bis verlärmten Rock-Experiment. Zwischen all dem Lärm funkelt aber immer wieder eine Spur Popliebhaberei der Marke Sonic Youth durch. Die Konfettihügelchen auf dem Frontcover machen es ja schon deutlich. Hier geht’s ziemlich bunt zu. Die Antlers sehen überhaupt keinen Grund, sich musikalisch irgendwie zu beschränken. Stattdessen entwerfen sie so eine Art Space-Lärm-Oper, die einen in einen wahren Rausch der Emotionen reißt. Nachdem ihre EP schon äußerst eindrucksvoll geriet, haben sie nun in Albumform nach gelegt und alle Befürchtungen zurück geschlagen, ihnen könnte auf Albumlänge eventuell die Puste ausgehen. „Tentacles“ läuft vielmehr geradezu über vor kreativen Einfällen und zauberhaften Passagen. Die Dynamik spielt bei dieser Band eine ganz entscheidende Rolle. Immer wieder wirkt der Schönklang noch erhabener, weil er von krachenden Passagen gekontert wird. Als Hörer befindet man sich in einem ständigen Strudel der Emotionen. Unberechenbarkeit als Prinzip könnte in großen Lettern über diesem Album stehen. Einem Album, dessen wahre Größe sich wohl erst in einigen Monaten wirklich erschließen dürfte.
Gentleman Reg aus Toronto versucht sich derweil auf seinem Album „Jet Black“ an klassischem Liedgut. Songwriter-Scheiben strahlen ja gerne mal so hell, wie verstaubte Glaskästen. Der Kanadier versteht es aber, das weit verbreitete Jack Johnson Phänomen, jeder Song müsse irgendwie gleich klingen, zu umschiffen. Da werden immer wieder schräge Chöre und Zweitstimmen eingestreut und wenn nicht, dann stimmt zumindest eine schmachtende Melodie zufrieden. Jedenfalls setzt man das ebenso betitelte Stück sofort auf „Rewind“. Seine Songs verankern sich irgendwo zwischen den Andockbuchsen von Elliott Smith, Aimee Mann und den Smiths und sorgen für ein lautes Pochen in den Herzkammern, wenn sie einen mit ihren absurden Ideen an der Nase herum führen. Ein insgesamt sehr liebenswertes Soloalbum des Hidden Cameras-Mitglieds. Versiert, abwechslungsreich und cineastisch. So, als wollte er der Filmmusik das Sprechen beibringen. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// von alexander nickel-hopfengart
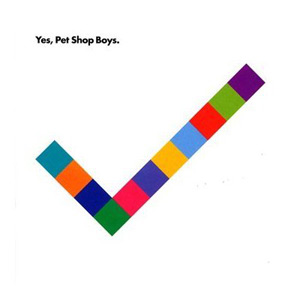 Vor kurzem wurde in einer großen Tageszeitung darauf hingewiesen, dass sich Popmusik im Gegensatz zu Rockmusik dem ständigen Wandel der Zeit anzupassen habe. Man kann also sagen, dass die Rolling Stones im Gegensatz zu Madonna von der Nostalgie profitieren, die ihrer Musik inne wohnt. Die Popmusik allerdings im Hier und Jetzt verankert ist und sich dadurch immer wieder aufs Neue beweisen muss. Das alles mag in gewisser Hinsicht richtig sein, denn sieht man sich ein Konzert von -sagen wir mal- Britney Spears anno 09 an, dann fällt auf, dass dort so gut wie keine alten Songs mehr im Programm sind – und wenn doch höchstens als Remix im aktuellen Gewand. Was das wiederum für das neue Album der
Vor kurzem wurde in einer großen Tageszeitung darauf hingewiesen, dass sich Popmusik im Gegensatz zu Rockmusik dem ständigen Wandel der Zeit anzupassen habe. Man kann also sagen, dass die Rolling Stones im Gegensatz zu Madonna von der Nostalgie profitieren, die ihrer Musik inne wohnt. Die Popmusik allerdings im Hier und Jetzt verankert ist und sich dadurch immer wieder aufs Neue beweisen muss. Das alles mag in gewisser Hinsicht richtig sein, denn sieht man sich ein Konzert von -sagen wir mal- Britney Spears anno 09 an, dann fällt auf, dass dort so gut wie keine alten Songs mehr im Programm sind – und wenn doch höchstens als Remix im aktuellen Gewand. Was das wiederum für das neue Album der 

 Wem das alles eine Spur zu poppig ist, dem sei hier ein Output der progressiven Gangart empfohlen.
Wem das alles eine Spur zu poppig ist, dem sei hier ein Output der progressiven Gangart empfohlen.  Wem das alles eine Spur zu schnell geht, wer sich lieber mal in die Hängematte schmeißt und die Sonne genießt, der könnte mit der schönsten Versuchung seit den Smiths warm werden.
Wem das alles eine Spur zu schnell geht, wer sich lieber mal in die Hängematte schmeißt und die Sonne genießt, der könnte mit der schönsten Versuchung seit den Smiths warm werden.  Hinterher verabreichen wir uns dann mal wieder eine echte Breitseite mit der Punkrockkeule. Mit Topfschlagen braucht man den
Hinterher verabreichen wir uns dann mal wieder eine echte Breitseite mit der Punkrockkeule. Mit Topfschlagen braucht man den 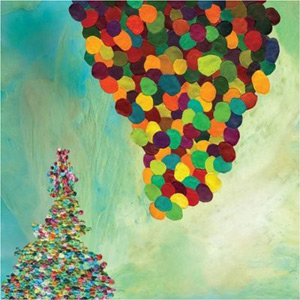 Ebenfalls lohnenswert gerät der neuste Wurf aus dem Hause
Ebenfalls lohnenswert gerät der neuste Wurf aus dem Hause 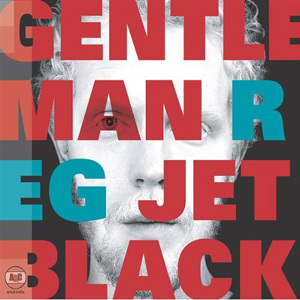
UND WAS NUN?