 Ja, Panik! Und zwar schnell. Wie ich diese Jungs schätze. Kein anderer Act aus Österreich vermischt zurzeit schmissige Popmusik so charmant mit Widerhaken, dass man sich selbst nach zwanzig Durchläufen noch fasziniert dem bunten Treiben hingibt, weil es vor Referenzen nur so strotzt. „The Angst & The Money“ schlendert leichtfüßig über das Feld, das Dylan, Morrissey, Surrogat, Rachut und Falco mit ihrer Musik bereits ausgiebig abgesteckt haben. Das mag sich jetzt für manchen ein bisschen widersprüchlich anhören, aber Ja, Panik schaffen es ihre Einflüsse in einer formvollendeten Einheit zu präsentieren. Dieses ständige Wechselspiel der Gefühle findet Ausdruck im Auflösen jeglicher Sprachbarrieren und Stil-Grenzen. Wenn die Band ganz beiläufig ins Englische wechselt. Wenn sie erst das Tempo drosselt und dann am Ende den ganzen Laden zu Bruch schlägt. Wenn Sänger Spechtl zum Ende eines Songs mehr spuckt und schreit, als singt, dann hat das alles nur ein einziges Ziel: Emotion und zwar auf Teufel komm raus. Darum geht’s bei dieser Musik. Und im ernst: es lohnt sich.
Ja, Panik! Und zwar schnell. Wie ich diese Jungs schätze. Kein anderer Act aus Österreich vermischt zurzeit schmissige Popmusik so charmant mit Widerhaken, dass man sich selbst nach zwanzig Durchläufen noch fasziniert dem bunten Treiben hingibt, weil es vor Referenzen nur so strotzt. „The Angst & The Money“ schlendert leichtfüßig über das Feld, das Dylan, Morrissey, Surrogat, Rachut und Falco mit ihrer Musik bereits ausgiebig abgesteckt haben. Das mag sich jetzt für manchen ein bisschen widersprüchlich anhören, aber Ja, Panik schaffen es ihre Einflüsse in einer formvollendeten Einheit zu präsentieren. Dieses ständige Wechselspiel der Gefühle findet Ausdruck im Auflösen jeglicher Sprachbarrieren und Stil-Grenzen. Wenn die Band ganz beiläufig ins Englische wechselt. Wenn sie erst das Tempo drosselt und dann am Ende den ganzen Laden zu Bruch schlägt. Wenn Sänger Spechtl zum Ende eines Songs mehr spuckt und schreit, als singt, dann hat das alles nur ein einziges Ziel: Emotion und zwar auf Teufel komm raus. Darum geht’s bei dieser Musik. Und im ernst: es lohnt sich.
 Genauso wie das neue Album von Jochen Distelmeyer. Der hat mit seiner ehemaligen Band Blumfeld nicht nur einen spürbaren Einfluss bei den panischen Jungs von gerade eben hinterlassen. Der übersetzt auf seinem neuen Album auch in bemerkenswerter Weise das Zwischenmenschliche in musikalischen Melodiebögen. Die kryptischen Texte von früher sind fast komplett aus dem Klangbild seines ersten Soloalbums verschwunden. Der Spoken Word Auftakt und das brachiale „Wohin mit dem Hass?“ führen den Hörer anfangs noch etwas in die irre, aber spätestens mit dem bemerkenswerten „Lass uns Liebe sein“ sollte auch dem letzten klar sein, wohin der Hase läuft. „Ich will wieder mit dir tanzen und dich lachen sehen. Ich hör den Himmel singen und hab genug vom Traurigsein. Und wenn Musik erklingt, dann weiß ich, ich bin nicht allein“. Das sind klare Worte, die durchaus im Stande sind, ein bestimmtes Gefühl in ein poetisches Kleid zu packen. Nach dem sehr gediegenen, letzten Blumfeld-Werk ist es schön, festzustellen, dass der Protagonist auf „Heavy“ das Tempo wieder anzieht. Textlich vollbringt Distelmeyer das Kunststück, den Spagat zwischen Befindlichkeitslyrik und Tiefsinn hinzukriegen. So finden sich fortan reihenweise imposante Textpassagen auf dem Album. Beispiel gefällig? Bitteschön… „Irgendwann hat es aufgehört, hat das Schweigen nicht mehr gestört, irgendwann waren wir zu wenig, für einander da. Wir haben gestritten und uns verletzt, und mit jedem Mal wurde ein goldener Käfig, was einmal Liebe war“. Das ist harter Tobak. „Heavy“ eben.
Genauso wie das neue Album von Jochen Distelmeyer. Der hat mit seiner ehemaligen Band Blumfeld nicht nur einen spürbaren Einfluss bei den panischen Jungs von gerade eben hinterlassen. Der übersetzt auf seinem neuen Album auch in bemerkenswerter Weise das Zwischenmenschliche in musikalischen Melodiebögen. Die kryptischen Texte von früher sind fast komplett aus dem Klangbild seines ersten Soloalbums verschwunden. Der Spoken Word Auftakt und das brachiale „Wohin mit dem Hass?“ führen den Hörer anfangs noch etwas in die irre, aber spätestens mit dem bemerkenswerten „Lass uns Liebe sein“ sollte auch dem letzten klar sein, wohin der Hase läuft. „Ich will wieder mit dir tanzen und dich lachen sehen. Ich hör den Himmel singen und hab genug vom Traurigsein. Und wenn Musik erklingt, dann weiß ich, ich bin nicht allein“. Das sind klare Worte, die durchaus im Stande sind, ein bestimmtes Gefühl in ein poetisches Kleid zu packen. Nach dem sehr gediegenen, letzten Blumfeld-Werk ist es schön, festzustellen, dass der Protagonist auf „Heavy“ das Tempo wieder anzieht. Textlich vollbringt Distelmeyer das Kunststück, den Spagat zwischen Befindlichkeitslyrik und Tiefsinn hinzukriegen. So finden sich fortan reihenweise imposante Textpassagen auf dem Album. Beispiel gefällig? Bitteschön… „Irgendwann hat es aufgehört, hat das Schweigen nicht mehr gestört, irgendwann waren wir zu wenig, für einander da. Wir haben gestritten und uns verletzt, und mit jedem Mal wurde ein goldener Käfig, was einmal Liebe war“. Das ist harter Tobak. „Heavy“ eben.
 Was uns hinterher gleich zur Abrissbirne im deutschen Popgeschäft führt. Mediengruppe Telekommander (am 29. September live in der Posthalle in Würzburg) sind zurück und haben elf Songs am Start, die genau dort ansetzen, wo der Vorgänger zuletzt viel zu schnell endete. Ehrlich gesagt ist die Mediengruppe ja schon immer eine bessere Live-, als Albumband gewesen. Bei ihren Shows, da hämmern sie alles in Grund und Boden, wenn sie einem gegenüber stehen. Ist wie bei Frittenbude und Egotronic, gegebenenfalls auch bei Deichkind. Da wird nicht lange gefackelt, da wird der Flammenwerfer ausgepackt. Musikalisches Krawallmachen ist angesagt und auch die neuen Songs eignen sich ganz hervorragend zum Leuchtstab in die Luft werfen und Kleidungsstück zerfetzen. „Einer muss in Führung gehen“ erlaubt sich dabei aber auch den ein oder anderen interessanten Sidekick, der den Stücken so eine gewisse Langlebigkeit einverleibt. Die Platte vermischt sozusagen die Hooklines des zweiten Albums mit den über weite Strecken famosen Textzeilen des Erstlingswerks. Mediengruppe Telekommander perfektionieren mit dieser Platte zunehmend ihren Soundentwurf und sind im Jahre 2009 der ultimative Schweißfleckengenerator für die bunt gekleidete Partymeute. Inzwischen ist die Band übrigens auch für Turbostaat-Fans interessant. Nachzuhören auf dem gleichnamigen Titel-Track. Ein wesentlich langlebigeres Album, als man erwarten durfte. Gut gemacht, Jungs.
Was uns hinterher gleich zur Abrissbirne im deutschen Popgeschäft führt. Mediengruppe Telekommander (am 29. September live in der Posthalle in Würzburg) sind zurück und haben elf Songs am Start, die genau dort ansetzen, wo der Vorgänger zuletzt viel zu schnell endete. Ehrlich gesagt ist die Mediengruppe ja schon immer eine bessere Live-, als Albumband gewesen. Bei ihren Shows, da hämmern sie alles in Grund und Boden, wenn sie einem gegenüber stehen. Ist wie bei Frittenbude und Egotronic, gegebenenfalls auch bei Deichkind. Da wird nicht lange gefackelt, da wird der Flammenwerfer ausgepackt. Musikalisches Krawallmachen ist angesagt und auch die neuen Songs eignen sich ganz hervorragend zum Leuchtstab in die Luft werfen und Kleidungsstück zerfetzen. „Einer muss in Führung gehen“ erlaubt sich dabei aber auch den ein oder anderen interessanten Sidekick, der den Stücken so eine gewisse Langlebigkeit einverleibt. Die Platte vermischt sozusagen die Hooklines des zweiten Albums mit den über weite Strecken famosen Textzeilen des Erstlingswerks. Mediengruppe Telekommander perfektionieren mit dieser Platte zunehmend ihren Soundentwurf und sind im Jahre 2009 der ultimative Schweißfleckengenerator für die bunt gekleidete Partymeute. Inzwischen ist die Band übrigens auch für Turbostaat-Fans interessant. Nachzuhören auf dem gleichnamigen Titel-Track. Ein wesentlich langlebigeres Album, als man erwarten durfte. Gut gemacht, Jungs.
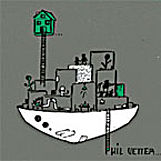 Das neue Album von Phil Vetter kommt derweil mit beiliegender Flaschenpost. Ein schicker Gimmick, der den Blick weit hinaus aufs Meer schweifen lässt. Musikalisch bewegt sich Vetter im Grenzgebiet von Coldplay und Snow Patrol, wobei hier ausdrücklich hinzu gefügt sei soll, dass er dabei immer wieder eine textliche Tiefe erlangt, die vor allem Ersteren manchmal abgeht. Das zwischenzeitliche Gezwitscher der Vögel im Hintergrund kann einem dabei zwar schon mal auf die Nerven fallen, weil der entsprechende Song („A New Page In My Diary“) dann auch noch gefährlich flach im Planschbecken von Jack Johnson fischt. Dennoch zeigt „I Pretend My Room´s A Sailing Boat“ mit all seinem Detailreichtum, dass auch in bayrischen Blaskapellen ganz hervorragende Musiker zuhause sind. Alle, die auf Jeff Buckley und Konsorten stehen, einfach mal einen Durchgang riskieren. Phil Vetter könnte bald mehr als nur ein Geheimtipp sein.
Das neue Album von Phil Vetter kommt derweil mit beiliegender Flaschenpost. Ein schicker Gimmick, der den Blick weit hinaus aufs Meer schweifen lässt. Musikalisch bewegt sich Vetter im Grenzgebiet von Coldplay und Snow Patrol, wobei hier ausdrücklich hinzu gefügt sei soll, dass er dabei immer wieder eine textliche Tiefe erlangt, die vor allem Ersteren manchmal abgeht. Das zwischenzeitliche Gezwitscher der Vögel im Hintergrund kann einem dabei zwar schon mal auf die Nerven fallen, weil der entsprechende Song („A New Page In My Diary“) dann auch noch gefährlich flach im Planschbecken von Jack Johnson fischt. Dennoch zeigt „I Pretend My Room´s A Sailing Boat“ mit all seinem Detailreichtum, dass auch in bayrischen Blaskapellen ganz hervorragende Musiker zuhause sind. Alle, die auf Jeff Buckley und Konsorten stehen, einfach mal einen Durchgang riskieren. Phil Vetter könnte bald mehr als nur ein Geheimtipp sein.
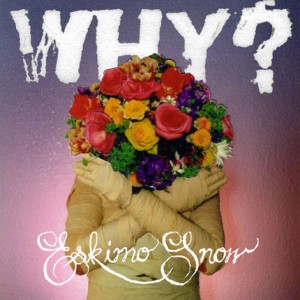 Bei den Jungs von Why? sind die Grenzen ja bereits auf dem letzten Album zunehmend weich gezeichnet worden. Das klang in etwa so, als würden die Jungs von den Roots ein Blackmail Coveralbum aufnehmen. Nun widmet sich das Kollektiv vollends der psychedelischen Glückseligkeit und legt mit „Eskimo Snow“ ein verstrahltes Popalbum vor, das nahtlos an „Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band“-Zeiten anschließt. Bei allen psychedelischen Spielereien ist „Eskimo Snow“ aber dennoch ein knackiges Werk geworden. Die Scheibe ist mit 35 Minuten nicht länger als ein durchschnittliches Popalbum der 60er Jahre und entpuppt sich als äußerst nachhaltig. All die Dinge, die man anfangs noch als störend empfindet, lösen sich nach und nach in Wohlgefallen auf. Dieses Album versucht die Rückwand der Sackgasse, in der HipHop heute gelandet ist, mit den Möglichkeiten des Pop zu zerlegen. „Eskimo Snow“ ist ein Grenzgänger zwischen den Genres, der die Möglichkeiten der modernen Musik an sich reißt und auf schlüssige Weise neu zusammensetzt. Dass sich Why? damit soundtechnisch direkt neben den Beatles anno 1967 einreihen, spricht in diesem Zusammenhang nicht direkt gegen die Musik. Es zeigt nur, wie weit die fantastischen Vier damals schon ihrer Zeit voraus waren.
Bei den Jungs von Why? sind die Grenzen ja bereits auf dem letzten Album zunehmend weich gezeichnet worden. Das klang in etwa so, als würden die Jungs von den Roots ein Blackmail Coveralbum aufnehmen. Nun widmet sich das Kollektiv vollends der psychedelischen Glückseligkeit und legt mit „Eskimo Snow“ ein verstrahltes Popalbum vor, das nahtlos an „Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band“-Zeiten anschließt. Bei allen psychedelischen Spielereien ist „Eskimo Snow“ aber dennoch ein knackiges Werk geworden. Die Scheibe ist mit 35 Minuten nicht länger als ein durchschnittliches Popalbum der 60er Jahre und entpuppt sich als äußerst nachhaltig. All die Dinge, die man anfangs noch als störend empfindet, lösen sich nach und nach in Wohlgefallen auf. Dieses Album versucht die Rückwand der Sackgasse, in der HipHop heute gelandet ist, mit den Möglichkeiten des Pop zu zerlegen. „Eskimo Snow“ ist ein Grenzgänger zwischen den Genres, der die Möglichkeiten der modernen Musik an sich reißt und auf schlüssige Weise neu zusammensetzt. Dass sich Why? damit soundtechnisch direkt neben den Beatles anno 1967 einreihen, spricht in diesem Zusammenhang nicht direkt gegen die Musik. Es zeigt nur, wie weit die fantastischen Vier damals schon ihrer Zeit voraus waren.
 Hinterher schicken wir dann Richard Hawley ins Rennen. Der werte Herr hat bereits sechs Soloalben draußen und ist Mitglied bei Pulp (gewesen). Ansonsten hat er mit „Truelove´s Gutter“ den offiziellen Nachfolger zu Johnny Cashs „American Recordings“ aus den Hüften geschüttelt. Wobei geschüttelt hier vielleicht das falsche Wort ist. Sagen wir lieber geschunkelt. Es geht nämlich ziemlich gediegen zu auf dem neuen Werk. Trotzdem dürfte jedem, der unvorbehalten an Musik rangeht, schon nach wenigen Sekunden klar sein, warum Alex Turner von den Arctic Monkeys ihm einst den so eben erhaltenen Mercury Prize zugestand. Hört man die Musik, wird sofort der Einfluss Hawleys auf die ruhigen Songs der Arctic Monkeys spürbar. Dazu gesellt sich aber auch sein neu entdeckter Mut zu belebten Momenten. Der Meister erliegt tatsächlich der Versuchung, mal aus seiner Schlummerecke zu kriechen und ein paar fröhliche Passagen, in dem Maße, wie Mr. Hawley und fröhlich eben zusammenpassen, in seine Songs einzustreuen. Alles in allem trotz aller Melancholie ein bemerkenswertes Alterswerk, dessen Tiefe sich erst nach mehrmaligem Hören éntfaltet.
Hinterher schicken wir dann Richard Hawley ins Rennen. Der werte Herr hat bereits sechs Soloalben draußen und ist Mitglied bei Pulp (gewesen). Ansonsten hat er mit „Truelove´s Gutter“ den offiziellen Nachfolger zu Johnny Cashs „American Recordings“ aus den Hüften geschüttelt. Wobei geschüttelt hier vielleicht das falsche Wort ist. Sagen wir lieber geschunkelt. Es geht nämlich ziemlich gediegen zu auf dem neuen Werk. Trotzdem dürfte jedem, der unvorbehalten an Musik rangeht, schon nach wenigen Sekunden klar sein, warum Alex Turner von den Arctic Monkeys ihm einst den so eben erhaltenen Mercury Prize zugestand. Hört man die Musik, wird sofort der Einfluss Hawleys auf die ruhigen Songs der Arctic Monkeys spürbar. Dazu gesellt sich aber auch sein neu entdeckter Mut zu belebten Momenten. Der Meister erliegt tatsächlich der Versuchung, mal aus seiner Schlummerecke zu kriechen und ein paar fröhliche Passagen, in dem Maße, wie Mr. Hawley und fröhlich eben zusammenpassen, in seine Songs einzustreuen. Alles in allem trotz aller Melancholie ein bemerkenswertes Alterswerk, dessen Tiefe sich erst nach mehrmaligem Hören éntfaltet.
 Strung Out scheinen derweil einen wahren Hürdenlauf in Sachen Outputs hinzulegen. Erst vor kurzem wurde eine gelungene Song-Kollektion veröffentlicht, nun steht schon wieder ein neues Album in den Startlöchern. Die Scheibe, die pünktlich zum 20sten der Band erscheint bietet die gewohnte Dosis Melodien mit metallischer Peitsche. Melodic Punk mit harten Gitarren also, der in seinen schönsten Momenten so dermaßen mitreißend gerät, dass man mit Stücken, wie „Carcrashradio“ am liebsten die Radioanlage der ollen Karre über das Limit hinaus strapazieren möchte. Keine Ahnung wie die Jungs das machen, aber nach dem etwas öden Opener knallen sie einem zehn Bretter vor den Latz, dass man meint, sie hätten gerade zum zweiten Mal ihr Debüt abgeliefert. „Agents Of The Underground“ ist die Punkrockschanze in Richtung Sommersonne. Schade nur, dass in diesen Tagen schon die letzten wärmenden Strahlen hinter herbstlichen Wolkenformationen verenden.
Strung Out scheinen derweil einen wahren Hürdenlauf in Sachen Outputs hinzulegen. Erst vor kurzem wurde eine gelungene Song-Kollektion veröffentlicht, nun steht schon wieder ein neues Album in den Startlöchern. Die Scheibe, die pünktlich zum 20sten der Band erscheint bietet die gewohnte Dosis Melodien mit metallischer Peitsche. Melodic Punk mit harten Gitarren also, der in seinen schönsten Momenten so dermaßen mitreißend gerät, dass man mit Stücken, wie „Carcrashradio“ am liebsten die Radioanlage der ollen Karre über das Limit hinaus strapazieren möchte. Keine Ahnung wie die Jungs das machen, aber nach dem etwas öden Opener knallen sie einem zehn Bretter vor den Latz, dass man meint, sie hätten gerade zum zweiten Mal ihr Debüt abgeliefert. „Agents Of The Underground“ ist die Punkrockschanze in Richtung Sommersonne. Schade nur, dass in diesen Tagen schon die letzten wärmenden Strahlen hinter herbstlichen Wolkenformationen verenden.
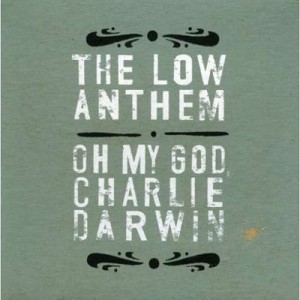 The Low Anthem mühen sich derweil, die Melodien, welche die Fleet Foxes immer so schön hinter vertrackten Rhythmen verstecken, in formvollendeter Klarheit an den Mann zu bringen. „Oh My God, Charlie Darwin“ ist ein Album auf dem sich die Emotionen niemals überschlagen. Hier hat alles seinen festen Platz, was die Sache aber nicht unbedingt unspannend macht. Bisweilen sind die Songs so zuckersüß, dass man sich wünscht, dieses Album würde einen in eine Wolke aus Zuckerwatte tunken. Von Selbiger darf man dann naschen, bis irgendwann die Bauchschmerzen einsetzen. Bei dieser Platte allerdings kann das lange dauern, denn Songs, wie „To Ohio“ und „Cage The Songbird“ werden immer wieder von schmissigen Momenten der Marke „The Horizon Is A Beltway“ und „Home I´ll Never Be“ gekontert, die mit ihrer punkigen Breitseite fast schon an die Musik von Two Gallants erinnern. Am Besten allerdings ist die Band immer dann, wenn Folk-Sprengsel auf puristischen Schönklang treffen. Manche werden The Low Anthem deshalb vielleicht des Diebstahls bei gewissen älteren Herrschaften verdächtigen. Mir ist das herzlich egal. Gut tut die Musik nämlich trotzdem. Also genießt dieses Album. Bis zum nächsten Zuckerbeat
The Low Anthem mühen sich derweil, die Melodien, welche die Fleet Foxes immer so schön hinter vertrackten Rhythmen verstecken, in formvollendeter Klarheit an den Mann zu bringen. „Oh My God, Charlie Darwin“ ist ein Album auf dem sich die Emotionen niemals überschlagen. Hier hat alles seinen festen Platz, was die Sache aber nicht unbedingt unspannend macht. Bisweilen sind die Songs so zuckersüß, dass man sich wünscht, dieses Album würde einen in eine Wolke aus Zuckerwatte tunken. Von Selbiger darf man dann naschen, bis irgendwann die Bauchschmerzen einsetzen. Bei dieser Platte allerdings kann das lange dauern, denn Songs, wie „To Ohio“ und „Cage The Songbird“ werden immer wieder von schmissigen Momenten der Marke „The Horizon Is A Beltway“ und „Home I´ll Never Be“ gekontert, die mit ihrer punkigen Breitseite fast schon an die Musik von Two Gallants erinnern. Am Besten allerdings ist die Band immer dann, wenn Folk-Sprengsel auf puristischen Schönklang treffen. Manche werden The Low Anthem deshalb vielleicht des Diebstahls bei gewissen älteren Herrschaften verdächtigen. Mir ist das herzlich egal. Gut tut die Musik nämlich trotzdem. Also genießt dieses Album. Bis zum nächsten Zuckerbeat
UND WAS NUN?