 Was hat David Lynch da nur wieder angerichtet? Mit seinen Sprüchen über das Wunderschöne am simplen Kreativsein hat der filmische Zaubermeister im ollen Elektrosympatisanten Moby einen Stimmungswandel erzeugt. Seitdem hat der Musiker einfach keine Lust mehr, einen mit fett produzierten Beats über die Tanzfläche zu schubsen. Vielmehr wirkt der Musiker seither seltsam in sich gekehrt, ja er wirkt sogar ein wenig besessen von der Idee, das Persönliche in seinen Songs in den Vordergrund zu stellen. So ist „Wait For Me“ dann auch das entspannteste Album seiner bisherigen Laufbahn geworden. Warm und offen sollen die Songs klingen und das tun sie auch. Das Schöne aber ist, dass diesmal trotzdem keine Langeweile aufkommt. Bei allen Alben von Moby war ja bisweilen die Verführung groß, alles zwischen den Hits weg zu skippen. „“Wait For Me“ wiederum wirkt wie aus einem Guss. Orientiert sich musikalisch ganz an den großen Popmomenten, die er einst mit „Why Does My Heart Feel So Bad?“ ins Rennen um die schönste Herzschmerzballade auf die Menschheit herab tröpfeln lies. Man kann sich zu dieser Scheibe einfach nur zurücklehnen und die Augen schließen. Eigentlich ist die Musik perfekt zum Zug fahren. Wenn die Welt an einem vorbei zieht und man scheinbar schwerelos durch die endlosen Weiten der Landschaft driftet. Moby ist auf „Wait For Me“ zum ersten Mal in seiner Karriere ganz bei sich. Der Punkrocker von früher ist zum Romantiker geworden. Mit solchen Songs verzeiht man ihm das nur zu gerne.
Was hat David Lynch da nur wieder angerichtet? Mit seinen Sprüchen über das Wunderschöne am simplen Kreativsein hat der filmische Zaubermeister im ollen Elektrosympatisanten Moby einen Stimmungswandel erzeugt. Seitdem hat der Musiker einfach keine Lust mehr, einen mit fett produzierten Beats über die Tanzfläche zu schubsen. Vielmehr wirkt der Musiker seither seltsam in sich gekehrt, ja er wirkt sogar ein wenig besessen von der Idee, das Persönliche in seinen Songs in den Vordergrund zu stellen. So ist „Wait For Me“ dann auch das entspannteste Album seiner bisherigen Laufbahn geworden. Warm und offen sollen die Songs klingen und das tun sie auch. Das Schöne aber ist, dass diesmal trotzdem keine Langeweile aufkommt. Bei allen Alben von Moby war ja bisweilen die Verführung groß, alles zwischen den Hits weg zu skippen. „“Wait For Me“ wiederum wirkt wie aus einem Guss. Orientiert sich musikalisch ganz an den großen Popmomenten, die er einst mit „Why Does My Heart Feel So Bad?“ ins Rennen um die schönste Herzschmerzballade auf die Menschheit herab tröpfeln lies. Man kann sich zu dieser Scheibe einfach nur zurücklehnen und die Augen schließen. Eigentlich ist die Musik perfekt zum Zug fahren. Wenn die Welt an einem vorbei zieht und man scheinbar schwerelos durch die endlosen Weiten der Landschaft driftet. Moby ist auf „Wait For Me“ zum ersten Mal in seiner Karriere ganz bei sich. Der Punkrocker von früher ist zum Romantiker geworden. Mit solchen Songs verzeiht man ihm das nur zu gerne.
 Wer sich die Tage wundert, dass schon wieder eine neue Scheibe von Franz Ferdinand im Regal steht -wenn auch nur in der Vinyl-Ecke der jeweiligen Filiale- dem sei gesagt, dass es sich bei „Blood“ um eine Dub-Version des Drittwerks „Tonight: Franz Ferdinand“ handelt. War ja auch nicht schwer zu erraten bei dem Covermotiv, oder? Aber was heißt hier eigentlich lediglich? „Blood“ macht nämlich verdammt viel Spaß. Für Dub-Puristen ist das Album zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Spur zu hektisch geraten, aber so schön abgehangen zu verstrahlten Popsongs habe ich schon lange nicht mehr. Da schlängeln sich die Melodien aus Rauchschwaden empor, dass man meint, man hätte sich in ein Nebelgebiet verirrt und starre in ein tiefes Loch, in dem sich exstatische Körper winden, die nur als schwache Silhouetten wahrzunehmen sind. Als wäre das noch nicht genug, gibt es dazu noch ein hübsches Schmankerl in Form des Bonus Stücks „Be Afraid“ – einer sympathisch verstrahlten Version von „Dream Again“, die sich auch als Rausschmeißer auf dem Hauptwerk gut gemacht hätte. Wer sich im Club gerne mal ins Hinterzimmer verzieht und auf einem verdaddelten Sofa der Dinge harrt. Den kann man „Blood“ nur ganz fest ans Herzkämmerchen pressen. Franz Ferdinand zeigen auch in der zweiten Reihe keinerlei Ausfall-Erscheinungen.
Wer sich die Tage wundert, dass schon wieder eine neue Scheibe von Franz Ferdinand im Regal steht -wenn auch nur in der Vinyl-Ecke der jeweiligen Filiale- dem sei gesagt, dass es sich bei „Blood“ um eine Dub-Version des Drittwerks „Tonight: Franz Ferdinand“ handelt. War ja auch nicht schwer zu erraten bei dem Covermotiv, oder? Aber was heißt hier eigentlich lediglich? „Blood“ macht nämlich verdammt viel Spaß. Für Dub-Puristen ist das Album zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Spur zu hektisch geraten, aber so schön abgehangen zu verstrahlten Popsongs habe ich schon lange nicht mehr. Da schlängeln sich die Melodien aus Rauchschwaden empor, dass man meint, man hätte sich in ein Nebelgebiet verirrt und starre in ein tiefes Loch, in dem sich exstatische Körper winden, die nur als schwache Silhouetten wahrzunehmen sind. Als wäre das noch nicht genug, gibt es dazu noch ein hübsches Schmankerl in Form des Bonus Stücks „Be Afraid“ – einer sympathisch verstrahlten Version von „Dream Again“, die sich auch als Rausschmeißer auf dem Hauptwerk gut gemacht hätte. Wer sich im Club gerne mal ins Hinterzimmer verzieht und auf einem verdaddelten Sofa der Dinge harrt. Den kann man „Blood“ nur ganz fest ans Herzkämmerchen pressen. Franz Ferdinand zeigen auch in der zweiten Reihe keinerlei Ausfall-Erscheinungen.
 Wer mal wieder einen HipHop-Fan weinen sehen möchte, der muss derweil mal die neue Scheibe von den Black Eyed Peas einlegen. Das war mal eine durchaus renommierte Band in raptechnischen Gefilden und jetzt haben sie vollends den Sprung zum Popact vollzogen. „The E.N.D.“ hat rein gar nichts mehr mit den Anfangstagen der Band gemein. Selbst der Rapmusik wird über weite Strecken abgeschworen. Stattdessen findet man elektronische Beats und verzerrte Auto-Tune-Takes, die wirken, als wollte da jemand die Reanimation von Cher einläuten. Was uns Kanye West zuletzt in überdosierter Form vor den Latz knallte, findet hier seine Vollendung in Partygewand. Die Musik besteht über weite Strecken nur noch geringfügig aus Strophen, sondern aus Hooks. Eigentlich ist das Album eine einzige Ansammlung von Refrains, die geringfügig von kurzen Rapparts unterbrochen werden. Das knallt gerade auf den ersten Blick natürlich ordentlich rein. Die neue Single „I Gotta Feeling“ ist so glänzend, dass man gar nicht genug kriegt von diesem Regen aus Seifenblasen. Leider zerplatzt aber so manche musikalische Phantasie beim zehnten Durchlauf, weil die Hooks sich irgendwann totlaufen. Und trotzdem habe ich seit Robbie Williams „Rudebox“ keine gelungenere Geschmackverirrung der jüngeren Popgeschichte mehr gehört.
Wer mal wieder einen HipHop-Fan weinen sehen möchte, der muss derweil mal die neue Scheibe von den Black Eyed Peas einlegen. Das war mal eine durchaus renommierte Band in raptechnischen Gefilden und jetzt haben sie vollends den Sprung zum Popact vollzogen. „The E.N.D.“ hat rein gar nichts mehr mit den Anfangstagen der Band gemein. Selbst der Rapmusik wird über weite Strecken abgeschworen. Stattdessen findet man elektronische Beats und verzerrte Auto-Tune-Takes, die wirken, als wollte da jemand die Reanimation von Cher einläuten. Was uns Kanye West zuletzt in überdosierter Form vor den Latz knallte, findet hier seine Vollendung in Partygewand. Die Musik besteht über weite Strecken nur noch geringfügig aus Strophen, sondern aus Hooks. Eigentlich ist das Album eine einzige Ansammlung von Refrains, die geringfügig von kurzen Rapparts unterbrochen werden. Das knallt gerade auf den ersten Blick natürlich ordentlich rein. Die neue Single „I Gotta Feeling“ ist so glänzend, dass man gar nicht genug kriegt von diesem Regen aus Seifenblasen. Leider zerplatzt aber so manche musikalische Phantasie beim zehnten Durchlauf, weil die Hooks sich irgendwann totlaufen. Und trotzdem habe ich seit Robbie Williams „Rudebox“ keine gelungenere Geschmackverirrung der jüngeren Popgeschichte mehr gehört.
 Metric zünden hinterher dann ein wahres Feuerwerk der Emotionen. „Help I´m Alive“ ist einer der zuckersüßesten Indie-Pop Songs des Jahres. Wenn sich dieses „…still i´m alive“ aus den musikalischen Nebelschwaden des Clubs schält, möchte man vor Glück einfach an die Decke hüpfen. Aber damit nicht genug. Die Single ist nämlich nur der Vorgeschmack auf ein famoses Elektro-Pop-Werk, das man so schnell nicht mehr aus den Gehörgängen der Partyfraktion verbannen können wird. „Fantasies“ hat alles, was ein zeitgenössisches Indie-Pop-Werk braucht. Irgendwo zwischen dem Erstling von The Gossip und dem creepy Sound von The Knife sind Metric eine Art partytaugliches Update für die Moloko-Fraktion. Dazu ein bisschen beschwingten Cardigans-Charme in die Hookline gepfeffert und fertig ist der Hit. „Fantasies“ wird gerade vielleicht ein bisschen im Fahrwasser der neuen The Gossip untergehen, weil Beth Ditto mit ihrer Musik die Titelseiten der einschlägigen Musikgazetten überlagert. In nicht allzu ferner Zeit aber wird dieses Werk hier noch mal an die Oberfläche geschwemmt werden und man wird sich zu Songs, wie „Satellite Mind“ und „Gold Guns And Girls“, die Klamotten vom Leib reißen, um sich möglichst viel Sonne in die Herzkammern zu spülen.
Metric zünden hinterher dann ein wahres Feuerwerk der Emotionen. „Help I´m Alive“ ist einer der zuckersüßesten Indie-Pop Songs des Jahres. Wenn sich dieses „…still i´m alive“ aus den musikalischen Nebelschwaden des Clubs schält, möchte man vor Glück einfach an die Decke hüpfen. Aber damit nicht genug. Die Single ist nämlich nur der Vorgeschmack auf ein famoses Elektro-Pop-Werk, das man so schnell nicht mehr aus den Gehörgängen der Partyfraktion verbannen können wird. „Fantasies“ hat alles, was ein zeitgenössisches Indie-Pop-Werk braucht. Irgendwo zwischen dem Erstling von The Gossip und dem creepy Sound von The Knife sind Metric eine Art partytaugliches Update für die Moloko-Fraktion. Dazu ein bisschen beschwingten Cardigans-Charme in die Hookline gepfeffert und fertig ist der Hit. „Fantasies“ wird gerade vielleicht ein bisschen im Fahrwasser der neuen The Gossip untergehen, weil Beth Ditto mit ihrer Musik die Titelseiten der einschlägigen Musikgazetten überlagert. In nicht allzu ferner Zeit aber wird dieses Werk hier noch mal an die Oberfläche geschwemmt werden und man wird sich zu Songs, wie „Satellite Mind“ und „Gold Guns And Girls“, die Klamotten vom Leib reißen, um sich möglichst viel Sonne in die Herzkammern zu spülen.
 Und wo kommen die denn jetzt her? Lovedrug aus Cleveland tun auf ihrem neuen Album mal eben so, als hätte es Dredg nie gegeben und Coldplay einem nie den Spaß an melancholischen Klängen versaut. „The Sucker Punch Show“ gibt sich nicht damit zufrieden, einfach nur den romantischen Sehnsüchten zu frönen, nein das Album packt auch hin und wieder die 70er Jahre Glamrockkeule aus und wirft dir eine gehörige Portion Glitter auf die Schultern. Viele sprechen bei dem Album schon von einem astreinen Geniestreich. So weit würde ich nicht gehen, aber es ist schon bemerkenswert, wie die Band Van Halen mit einer Bootstour im Mondschein verknüpft und damit auch noch durchkommt. Jedes Mal, wenn man das Gefühl bekommt, jetzt müsste es peinlich werden, ziehen sie einen wieder zurück ins Trockene auf kontern die plakativen Anmaßungen des Glamrock-Genres mit einem fetten Augenzwinkern. Den größten Profit schlägt die Band dabei aus ihren Melodien, die sich immer wieder gegenseitig an Intensität übertreffen. Für sich allein genommen ist dieses Album hier eine einzige Frechheit, eine Geschmacksverirrung sonders gleichen, aber Lovedrug schaffen es, dass man alle Hemmungen urplötzlich über Bord wirft. Sie machen den 70er Jahre Rock wieder konsensfähig und greifen mit diesem Album zur Krone des Hardrock, die Guns´n´Roses zuletzt so leichtfertig abgelegt haben. Wie sie das machen? Keine Ahnung… aber es funktioniert, verdammte Scheiße.
Und wo kommen die denn jetzt her? Lovedrug aus Cleveland tun auf ihrem neuen Album mal eben so, als hätte es Dredg nie gegeben und Coldplay einem nie den Spaß an melancholischen Klängen versaut. „The Sucker Punch Show“ gibt sich nicht damit zufrieden, einfach nur den romantischen Sehnsüchten zu frönen, nein das Album packt auch hin und wieder die 70er Jahre Glamrockkeule aus und wirft dir eine gehörige Portion Glitter auf die Schultern. Viele sprechen bei dem Album schon von einem astreinen Geniestreich. So weit würde ich nicht gehen, aber es ist schon bemerkenswert, wie die Band Van Halen mit einer Bootstour im Mondschein verknüpft und damit auch noch durchkommt. Jedes Mal, wenn man das Gefühl bekommt, jetzt müsste es peinlich werden, ziehen sie einen wieder zurück ins Trockene auf kontern die plakativen Anmaßungen des Glamrock-Genres mit einem fetten Augenzwinkern. Den größten Profit schlägt die Band dabei aus ihren Melodien, die sich immer wieder gegenseitig an Intensität übertreffen. Für sich allein genommen ist dieses Album hier eine einzige Frechheit, eine Geschmacksverirrung sonders gleichen, aber Lovedrug schaffen es, dass man alle Hemmungen urplötzlich über Bord wirft. Sie machen den 70er Jahre Rock wieder konsensfähig und greifen mit diesem Album zur Krone des Hardrock, die Guns´n´Roses zuletzt so leichtfertig abgelegt haben. Wie sie das machen? Keine Ahnung… aber es funktioniert, verdammte Scheiße.
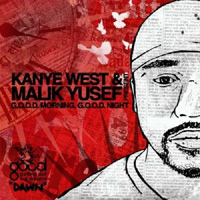
 Ziemlich poppig geht es anschließend weiter mit zwei Veröffentlichungen aus dem Hause Kanye West & Malik Yusef. Die präsentieren auf „G.O.O.D. Morning G.O.O.D. Night“ einen emotionalen Mix der Gefühle über zwei Runden. Eingeläutet vom zauberhaften Gesang von Jennifer Hudson entpuppt sich die zweite Scheibe –genannt „Dusk“- im Nachhinein als das gelungenere Tune. Die zahlreichen Stimmen der Gäste verschmelzen wie von selbst zu einer homogenen Einheit, wobei vor allem die Gasbeiträge von Mr. Hudson („The Return“ zusammen mit Yaw) und das famose „Magic Man“ mit freundlicher Unterstützung von niemand geringerem als Common und John Legend hervorzuheben sind. Der entspannte Sound der Scheibe verschafft den Künstlern von Zzaje bis Vaughn Anthony einen musikalischen Unterbau, auf den sich die Gaststars nur zu gerne austoben. An Featuregästen haben West und Yusef auf beiden Scheiben nicht gespart. Es dürften mit Sicherheit an die 50 sein. Davon befinden sich die größten Namen allerdings auf Scheibe eins. „Dawn“ wird unter anderem befeuert von niemand geringerem als Adam Levine (Maroon 5), KRS-1, Twista, Michelle Williams und Big Sean. Die Musik klingt abermals entspannt und man ist glücklich, von West mal keine „Auto-Tune“-Phantasien um die Ohren geballert zu bekommen. Stattdessen gibt’s große Popsongs gepaart mit versierten Raps, die nur selten wirken, als wären sie Ausschuss-Ware vom letzten Studiowerk. „G.O.O.D. Morning G.O.O.D. Night“ erschlägt einen dabei vielleicht anfangs etwas aufgrund seiner epischen Länge und wird wohl auch deshalb getrennt auf „Dusk“ und „Dawn“ veröffentlicht. Am Ende aber muss man lange nach einer Veröffentlichung suchen, die über so weite Strecken nahezu ohne einen einzigen Ausfall daher kommt. Insgesamt ist „G.O.O.D. Morning G.O.O.D. Night“ damit allemal besser, als das letzte Solowerk von West, dessen Mut zum Risiko man zwar bewundern darf, der sich aber auch gerne mal wieder an seiner Paradedisziplin versuchen darf.
Ziemlich poppig geht es anschließend weiter mit zwei Veröffentlichungen aus dem Hause Kanye West & Malik Yusef. Die präsentieren auf „G.O.O.D. Morning G.O.O.D. Night“ einen emotionalen Mix der Gefühle über zwei Runden. Eingeläutet vom zauberhaften Gesang von Jennifer Hudson entpuppt sich die zweite Scheibe –genannt „Dusk“- im Nachhinein als das gelungenere Tune. Die zahlreichen Stimmen der Gäste verschmelzen wie von selbst zu einer homogenen Einheit, wobei vor allem die Gasbeiträge von Mr. Hudson („The Return“ zusammen mit Yaw) und das famose „Magic Man“ mit freundlicher Unterstützung von niemand geringerem als Common und John Legend hervorzuheben sind. Der entspannte Sound der Scheibe verschafft den Künstlern von Zzaje bis Vaughn Anthony einen musikalischen Unterbau, auf den sich die Gaststars nur zu gerne austoben. An Featuregästen haben West und Yusef auf beiden Scheiben nicht gespart. Es dürften mit Sicherheit an die 50 sein. Davon befinden sich die größten Namen allerdings auf Scheibe eins. „Dawn“ wird unter anderem befeuert von niemand geringerem als Adam Levine (Maroon 5), KRS-1, Twista, Michelle Williams und Big Sean. Die Musik klingt abermals entspannt und man ist glücklich, von West mal keine „Auto-Tune“-Phantasien um die Ohren geballert zu bekommen. Stattdessen gibt’s große Popsongs gepaart mit versierten Raps, die nur selten wirken, als wären sie Ausschuss-Ware vom letzten Studiowerk. „G.O.O.D. Morning G.O.O.D. Night“ erschlägt einen dabei vielleicht anfangs etwas aufgrund seiner epischen Länge und wird wohl auch deshalb getrennt auf „Dusk“ und „Dawn“ veröffentlicht. Am Ende aber muss man lange nach einer Veröffentlichung suchen, die über so weite Strecken nahezu ohne einen einzigen Ausfall daher kommt. Insgesamt ist „G.O.O.D. Morning G.O.O.D. Night“ damit allemal besser, als das letzte Solowerk von West, dessen Mut zum Risiko man zwar bewundern darf, der sich aber auch gerne mal wieder an seiner Paradedisziplin versuchen darf.
 Und weiter geht’s mit etwas subtilerem Elektro-Pop aus dem Hause „Warp“. „Totems Flare“ von Clark ist mal wieder ein echter Brocken von Album. Ein dynamischer wohlgemerkt, dessen größte Stärke es ist, dass man dazu trotzdem schweißüberströmt im Kreis hüpfen kann, ohne sich gleich als Fan der Chemical Brothers outen zu müssen. Es ist eben doch möglich direkte Songs mit einem gewissen Anspruch zu untermauern. Clark könnte es mit diesem Album glatt auf die große Bühne schaffen, wenn er es denn darauf anlegen würde. Großspurig genug ist er ja, wenn er selbst über das Album sagt: Das schwierigste an der ganzen Sache ist die Songauswahl gewesen. Der Typ scheint ja wirklich einen monstermäßigen Output am Start zu haben. Und ganz im ernst: was er hier so fabriziert; wie er einen atemlosen Rave mit Hooklins und Gitarrenriffs aufpumpt. Da kann man als Hörer schon mal ins Schwärmen und Schwitzen geraten. Der Hitappeal dieser Scheibe übertrifft alle Erwartungen. Für den Moment ist „Totems Flare“ ein einziger Triumph. Bleibt nur zu hoffen, dass er damit nicht ins Kiesbett des Formatradios schlittert.
Und weiter geht’s mit etwas subtilerem Elektro-Pop aus dem Hause „Warp“. „Totems Flare“ von Clark ist mal wieder ein echter Brocken von Album. Ein dynamischer wohlgemerkt, dessen größte Stärke es ist, dass man dazu trotzdem schweißüberströmt im Kreis hüpfen kann, ohne sich gleich als Fan der Chemical Brothers outen zu müssen. Es ist eben doch möglich direkte Songs mit einem gewissen Anspruch zu untermauern. Clark könnte es mit diesem Album glatt auf die große Bühne schaffen, wenn er es denn darauf anlegen würde. Großspurig genug ist er ja, wenn er selbst über das Album sagt: Das schwierigste an der ganzen Sache ist die Songauswahl gewesen. Der Typ scheint ja wirklich einen monstermäßigen Output am Start zu haben. Und ganz im ernst: was er hier so fabriziert; wie er einen atemlosen Rave mit Hooklins und Gitarrenriffs aufpumpt. Da kann man als Hörer schon mal ins Schwärmen und Schwitzen geraten. Der Hitappeal dieser Scheibe übertrifft alle Erwartungen. Für den Moment ist „Totems Flare“ ein einziger Triumph. Bleibt nur zu hoffen, dass er damit nicht ins Kiesbett des Formatradios schlittert.
 Alle Fans von den Dresden Dolls sollten sich derweil mal das neue Album von Julia Marcell zu Gemüte führen. Die junge Künstlerin aus Polen versammelt auf „It Might Like You“ klassische Pianoklänge und verziert sie mit ihrer sprunghaften Stimme. Der Aufschrei in Bezug auf ihre Musik mag bisher zwar nicht besonders groß gewesen sein, aber was sagt das schon wirklich über die Größe von Musik?! Julia Marcells Platte lebt vorwiegend von den Geschichten. Dass sie es zudem versteht, den klassischen Ansatz der Songs mit dem Sound der gegenwärtigen Popmusikszene zu verpendeln, ohne dabei in plakatives Heulsusen-Gedönse der Marke Evanesence abzudriften, kann man ihr gar nicht zu hoch anrechnen. Am ehesten ist die Musik auf „It Might Like You“ vielleicht noch mit der von Kate Nash vergleichbar, die ja wiederum gekonnt bei Regina Spektor abgekupfert hat. Wer also mal wieder auf der Suche nach einem Kabarett der ganz großen Gefühle ist, er sollte sich diese Scheibe nicht entgehen lassen.
Alle Fans von den Dresden Dolls sollten sich derweil mal das neue Album von Julia Marcell zu Gemüte führen. Die junge Künstlerin aus Polen versammelt auf „It Might Like You“ klassische Pianoklänge und verziert sie mit ihrer sprunghaften Stimme. Der Aufschrei in Bezug auf ihre Musik mag bisher zwar nicht besonders groß gewesen sein, aber was sagt das schon wirklich über die Größe von Musik?! Julia Marcells Platte lebt vorwiegend von den Geschichten. Dass sie es zudem versteht, den klassischen Ansatz der Songs mit dem Sound der gegenwärtigen Popmusikszene zu verpendeln, ohne dabei in plakatives Heulsusen-Gedönse der Marke Evanesence abzudriften, kann man ihr gar nicht zu hoch anrechnen. Am ehesten ist die Musik auf „It Might Like You“ vielleicht noch mit der von Kate Nash vergleichbar, die ja wiederum gekonnt bei Regina Spektor abgekupfert hat. Wer also mal wieder auf der Suche nach einem Kabarett der ganz großen Gefühle ist, er sollte sich diese Scheibe nicht entgehen lassen.
 Und jetzt bitte „nicht schon wieder so eine Promo, wo sie über die Musik drüber labern“, denke ich noch, als „Shackleton`s Voyage“ von Eureka die Boxen flutet. Doch dann muss ich feststellen, dass das ja zum Konzept gehört. Besser macht das die Musik allerdings auch nicht. Yes als Einfluss zu nennen, ist ja inzwischen gang und gäbe in der Progrock-Szene und auch wenn hier Billy Sherwood höchstpersönlich auf zwei Songs mitsingt (die ganz nebenbei mit Abstand die besten der Platte sind), erzeugt der oftmals instrumentale Allerlei ansonsten ganz furchterregende Erinnerungen an den Soundtrack von „Titanic“.
Und jetzt bitte „nicht schon wieder so eine Promo, wo sie über die Musik drüber labern“, denke ich noch, als „Shackleton`s Voyage“ von Eureka die Boxen flutet. Doch dann muss ich feststellen, dass das ja zum Konzept gehört. Besser macht das die Musik allerdings auch nicht. Yes als Einfluss zu nennen, ist ja inzwischen gang und gäbe in der Progrock-Szene und auch wenn hier Billy Sherwood höchstpersönlich auf zwei Songs mitsingt (die ganz nebenbei mit Abstand die besten der Platte sind), erzeugt der oftmals instrumentale Allerlei ansonsten ganz furchterregende Erinnerungen an den Soundtrack von „Titanic“.
 Nur schnell weg also und zum Abschluss noch mal in ein ebenso ausuferndes, aber gleichsam mitreißendes Popalbum reingehört. Black Moth Super Rainbow nennt sich die Vocoder-Pop-Combo, die mit „Eating Us“ einen Zwitter aus Beatles-Melodien und verstrahlten Melodien der Marke Moloko fabriziert. Die verzerrte, weibliche Gesangsstimme strahlt dabei eine Kiffer-Romantik aus, dass man sich sofort in einen schwerelosen Raum beamen möchte, um mehrer Salti rückwärts zu absolvieren. Irgendwie scheint diese Musik gefangen in den endlosen Weiten der Popgeschichte – mit nostalgischem Flair steuern Black Moth Super Rainbow geradewegs in Gefilde abseits jeglicher Konventionen. Warum das trotzdem irgendwie schmissig und kurzweilig wirkt und die ausufernden Klänge nicht ins Uferlose abdriften. Gute Frage. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Deshalb Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Nur schnell weg also und zum Abschluss noch mal in ein ebenso ausuferndes, aber gleichsam mitreißendes Popalbum reingehört. Black Moth Super Rainbow nennt sich die Vocoder-Pop-Combo, die mit „Eating Us“ einen Zwitter aus Beatles-Melodien und verstrahlten Melodien der Marke Moloko fabriziert. Die verzerrte, weibliche Gesangsstimme strahlt dabei eine Kiffer-Romantik aus, dass man sich sofort in einen schwerelosen Raum beamen möchte, um mehrer Salti rückwärts zu absolvieren. Irgendwie scheint diese Musik gefangen in den endlosen Weiten der Popgeschichte – mit nostalgischem Flair steuern Black Moth Super Rainbow geradewegs in Gefilde abseits jeglicher Konventionen. Warum das trotzdem irgendwie schmissig und kurzweilig wirkt und die ausufernden Klänge nicht ins Uferlose abdriften. Gute Frage. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Deshalb Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
UND WAS NUN?