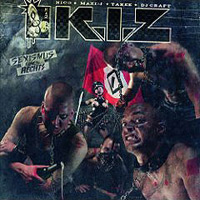 „Nicht schon wieder“ werden sich viele denken, wenn ihnen das neue Album von K.I.Z. den Blick auf die Jackson Gedächtnis Denkmale vernebelt. Musste das wirklich sein? Ein neues Album von den nimmermüden Proleten aus Berlin, denen kein Scherz zu krank ist? Die Spex scheint es jedenfalls gut zu finden, schließlich hat sie den Jungs erst vor Kurzem die letzte Seite ihres Magazins zur Verfügung gestellt. Und in die Jahrescharts haben sie es mit „Hahnenkampf“ ja auch geschafft. Dabei war der Vorgänger -oberflächlich betrachtet- eigentlich ziemlich doof. Das ewige Gewäsch über Titten konnte einem irgendwann so sehr auf den Sack gehen, dass man sich irgendwie schon fast wieder verstanden fühlte, wenn sie sich ironisch selbst aufs Korn nahmen: „Das ist meine letzte Nacht, Licht auf mich ich hol den Sack raus, früher gab’s für so was Ritalin, heute Applaus.“ Nun ja, es ist ein Dilemma mit K.I.Z.. Dabei ging es den Jungs doch seither um eine bewusst radikalisierte Form des Wortwitzes, der nun im Albumtitel „Sexismus gegen Rechts“ seine formvollendete Entsprechung findet. Da allerdings beginnt auch das Problem an der ganzen Geschichte. Sexistisch geht’s nämlich auch auf dem neuen Album wieder zu. Bewusst übertrieben wird sowieso. Stellt sich nur die Frage, warum eigentlich? K.I.Z. haben das eigentlich gar nicht nötig. Die sind raptechnisch allein auf weiter Flur, zumindest hinsichtlich härterer Rapmusik. Oder wissen sie insgeheim, dass Rap hierzulande nur noch funktioniert, wenn er möglichst breitenwirksam aneckt. So wie ein Satz, wie „Sexismus gegen Rechts“, der das Dilemma zusammen fasst. Scheiße mit Scheiße zu bekämpfen sorgt nämlich nicht für Schokotorte, sondern für noch mehr Scheiße. Dabei könnte die Mucke eigentlich richtig geil sein, würden sie inhaltlich ein wenig mehr variieren. Wie sagte Dendemann so schön? Ach ja, genau… „Doch Geld und Rap sind wie Smegma und Eichel. Das Game macht Zivis aggro wie Specter und Spaiche. Guck ma hier – bling – Kopp oder Zahl. Du willst Liebe und die Miete, das ist Doppelmoral“. K.I.Z. würde man solch hintersinnige Sätze auch zutrauen, nur klingt es bei ihnen heute noch eher so: „ich mach dir schöne Augen, so wie Chris Brown“. Autsch, das reißen dann der gelungene Punkstampfer „Das System©“ und die beiden tollen Tracks zum Abschluss auch nicht mehr raus. Aber vielleicht kommen wir ja beim nächsten Mal zusammen. Mal abwarten…
„Nicht schon wieder“ werden sich viele denken, wenn ihnen das neue Album von K.I.Z. den Blick auf die Jackson Gedächtnis Denkmale vernebelt. Musste das wirklich sein? Ein neues Album von den nimmermüden Proleten aus Berlin, denen kein Scherz zu krank ist? Die Spex scheint es jedenfalls gut zu finden, schließlich hat sie den Jungs erst vor Kurzem die letzte Seite ihres Magazins zur Verfügung gestellt. Und in die Jahrescharts haben sie es mit „Hahnenkampf“ ja auch geschafft. Dabei war der Vorgänger -oberflächlich betrachtet- eigentlich ziemlich doof. Das ewige Gewäsch über Titten konnte einem irgendwann so sehr auf den Sack gehen, dass man sich irgendwie schon fast wieder verstanden fühlte, wenn sie sich ironisch selbst aufs Korn nahmen: „Das ist meine letzte Nacht, Licht auf mich ich hol den Sack raus, früher gab’s für so was Ritalin, heute Applaus.“ Nun ja, es ist ein Dilemma mit K.I.Z.. Dabei ging es den Jungs doch seither um eine bewusst radikalisierte Form des Wortwitzes, der nun im Albumtitel „Sexismus gegen Rechts“ seine formvollendete Entsprechung findet. Da allerdings beginnt auch das Problem an der ganzen Geschichte. Sexistisch geht’s nämlich auch auf dem neuen Album wieder zu. Bewusst übertrieben wird sowieso. Stellt sich nur die Frage, warum eigentlich? K.I.Z. haben das eigentlich gar nicht nötig. Die sind raptechnisch allein auf weiter Flur, zumindest hinsichtlich härterer Rapmusik. Oder wissen sie insgeheim, dass Rap hierzulande nur noch funktioniert, wenn er möglichst breitenwirksam aneckt. So wie ein Satz, wie „Sexismus gegen Rechts“, der das Dilemma zusammen fasst. Scheiße mit Scheiße zu bekämpfen sorgt nämlich nicht für Schokotorte, sondern für noch mehr Scheiße. Dabei könnte die Mucke eigentlich richtig geil sein, würden sie inhaltlich ein wenig mehr variieren. Wie sagte Dendemann so schön? Ach ja, genau… „Doch Geld und Rap sind wie Smegma und Eichel. Das Game macht Zivis aggro wie Specter und Spaiche. Guck ma hier – bling – Kopp oder Zahl. Du willst Liebe und die Miete, das ist Doppelmoral“. K.I.Z. würde man solch hintersinnige Sätze auch zutrauen, nur klingt es bei ihnen heute noch eher so: „ich mach dir schöne Augen, so wie Chris Brown“. Autsch, das reißen dann der gelungene Punkstampfer „Das System©“ und die beiden tollen Tracks zum Abschluss auch nicht mehr raus. Aber vielleicht kommen wir ja beim nächsten Mal zusammen. Mal abwarten…
 Womit wir uns einer weiteren Crew aus deutschen HipHop-Gefilden widmen. Diesmal steh ich allerdings mit offenem Mund vor der Anlage. Wie kann ein Crew, die plakativer Weise Dickes B heißt, nur so ein derbes Album abliefern und damit nicht aus dem Stand in die Herzen der Szene hüpfen. „Original“ protzt mit strahlenden Hits, da braucht man gar nicht groß polieren. Die Jungs musizieren einfach drauf los und reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Dass Summsemann auch dabei ist… umso besser. Passt auch gut zum entspannten Sound der Scheibe, die irgendwo zwischen Seeed´schem Hängemattenstyle und raptechnischer Breitseite a la Massive Töne und Denyo durch die Welt schlurft. Die zehn Songs transportieren dabei den Wortwitz der 90er zehn Jahre nach vorne und scheren sich einen Scheiß darum, dass die Charts inzwischen von härteren Kalibern besetzt sind. Nein, Dickes B schaffen sich ihre eigene Nische und werfen die Frage auf, wann endlich mal wieder eine Welle wortwitzigen Raps auf die breite Zuhörerschaft hinab stürzt. Wer damals zu Doppelkopf, Dynamite Deluxe und Eins Zwo kopfhörerüberhangen durch die Nacht streifte, wird in diesem Album sicher einen guten Freund finden.
Womit wir uns einer weiteren Crew aus deutschen HipHop-Gefilden widmen. Diesmal steh ich allerdings mit offenem Mund vor der Anlage. Wie kann ein Crew, die plakativer Weise Dickes B heißt, nur so ein derbes Album abliefern und damit nicht aus dem Stand in die Herzen der Szene hüpfen. „Original“ protzt mit strahlenden Hits, da braucht man gar nicht groß polieren. Die Jungs musizieren einfach drauf los und reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Dass Summsemann auch dabei ist… umso besser. Passt auch gut zum entspannten Sound der Scheibe, die irgendwo zwischen Seeed´schem Hängemattenstyle und raptechnischer Breitseite a la Massive Töne und Denyo durch die Welt schlurft. Die zehn Songs transportieren dabei den Wortwitz der 90er zehn Jahre nach vorne und scheren sich einen Scheiß darum, dass die Charts inzwischen von härteren Kalibern besetzt sind. Nein, Dickes B schaffen sich ihre eigene Nische und werfen die Frage auf, wann endlich mal wieder eine Welle wortwitzigen Raps auf die breite Zuhörerschaft hinab stürzt. Wer damals zu Doppelkopf, Dynamite Deluxe und Eins Zwo kopfhörerüberhangen durch die Nacht streifte, wird in diesem Album sicher einen guten Freund finden.
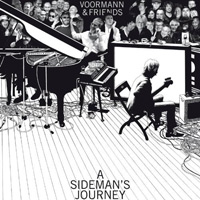 Der Hamburger Klaus Voormann bewegte sich derweil Zeit seines Lebens im Fahrwasser der ganz Großen. Die Beatles pflegen eine lange und intensive Freundschaft zu dem Musiker und so ist es auch kein Wunder, dass Paul McCartney den Auftakt von „A Sideman´s Journey“ mit seiner herzerwärmenden Gesangsstimme ausstatten darf. Voormann & Friends bietet aber auch abseits von McCartney allerhand Bemerkenswertes, zum Beispiel von Yusuf Islam alias Cat Stevens, der hier mit „All Things Must Pass“ einen seiner schönsten Beiträge der letzten Jahre beisteuert. Dazu darf man sich auch noch als Wohltäter fühlen, wenn man das Werk sein eigen nennt: Ein Teil der Einnahmen geht nämlich an die vom Aussterben bedrohten Indianer vom Stamm der Oglala Lakota. Das ist eine äußerst gute Sache. Wobei alle Fans nostalgisch angehauchter Rockklänge noch darauf hingewiesen seien, dass es die Scheibe auch als Buchexemplar gibt. Mit Kunstdrucken wohlgemerkt. Ganz großes Kino von einem ganz Großen. Hört mal rein.
Der Hamburger Klaus Voormann bewegte sich derweil Zeit seines Lebens im Fahrwasser der ganz Großen. Die Beatles pflegen eine lange und intensive Freundschaft zu dem Musiker und so ist es auch kein Wunder, dass Paul McCartney den Auftakt von „A Sideman´s Journey“ mit seiner herzerwärmenden Gesangsstimme ausstatten darf. Voormann & Friends bietet aber auch abseits von McCartney allerhand Bemerkenswertes, zum Beispiel von Yusuf Islam alias Cat Stevens, der hier mit „All Things Must Pass“ einen seiner schönsten Beiträge der letzten Jahre beisteuert. Dazu darf man sich auch noch als Wohltäter fühlen, wenn man das Werk sein eigen nennt: Ein Teil der Einnahmen geht nämlich an die vom Aussterben bedrohten Indianer vom Stamm der Oglala Lakota. Das ist eine äußerst gute Sache. Wobei alle Fans nostalgisch angehauchter Rockklänge noch darauf hingewiesen seien, dass es die Scheibe auch als Buchexemplar gibt. Mit Kunstdrucken wohlgemerkt. Ganz großes Kino von einem ganz Großen. Hört mal rein.
 Dass Mew mit ihrem neuen Album ebenfalls etwas Großes vorhaben, merkt man schon am orchestralen Auftakt. Der klingt, als hätten Muse mit Elbow fusioniert und alles aufgefahren, was sie im Kofferraum ihres boxenbelladenen Wagens versteckt haben. Im Info wird derweil von labyrinthisch überlappenden Arrangements gefachsimpelt, wobei man bei diesem Album nicht die Kraft der schönen Melodien unterschätzen sollte. Mew haben nämlich nicht nur ein ambitioniertes Monster geschaffen, „No More Stories“ glänzt auch abseits der schillernden Produktion. Die Stücke sind dermaßen harmonieverliebt, dass man sich höchstens noch an der helium-durchfluteten Stimme des Frontmanns stoßen könnte, wäre man nicht schon lange ins Freie gerannt, um sich in den unendlichen Möglichkeiten des Weltenraums um die eigene Achse zu drehen. Yep, Mew loten mit diesem Album nahezu alle Klangspektren aus, die mit moderner Rockmusik abzuklopfen sind. Das wirkt bisweilen kitschig, strotzt aber nur so vor Hingabe. Wer mal wieder eine ganz große Space-Oper mit zeitgenössischer Geste erleben will. „No More Stories“ könnte sein neues Lieblingsalbum sein.
Dass Mew mit ihrem neuen Album ebenfalls etwas Großes vorhaben, merkt man schon am orchestralen Auftakt. Der klingt, als hätten Muse mit Elbow fusioniert und alles aufgefahren, was sie im Kofferraum ihres boxenbelladenen Wagens versteckt haben. Im Info wird derweil von labyrinthisch überlappenden Arrangements gefachsimpelt, wobei man bei diesem Album nicht die Kraft der schönen Melodien unterschätzen sollte. Mew haben nämlich nicht nur ein ambitioniertes Monster geschaffen, „No More Stories“ glänzt auch abseits der schillernden Produktion. Die Stücke sind dermaßen harmonieverliebt, dass man sich höchstens noch an der helium-durchfluteten Stimme des Frontmanns stoßen könnte, wäre man nicht schon lange ins Freie gerannt, um sich in den unendlichen Möglichkeiten des Weltenraums um die eigene Achse zu drehen. Yep, Mew loten mit diesem Album nahezu alle Klangspektren aus, die mit moderner Rockmusik abzuklopfen sind. Das wirkt bisweilen kitschig, strotzt aber nur so vor Hingabe. Wer mal wieder eine ganz große Space-Oper mit zeitgenössischer Geste erleben will. „No More Stories“ könnte sein neues Lieblingsalbum sein.
 Graham Coxon versucht derweil mit seinem neuen Album endlich aus dem übergroßen Schatten von Blur zu treten. „The Spinning Top“ wirkt, als hätten Nick Drake und der großartige Sean Lennon ein entspanntes Dinner vorm Kamin veranstaltet und sich zunehmend von der knisternden Szenerie anstecken lassen. Man kann das Album gut durchlaufen lassen, wenn man sich mal wieder romantisch mit der Liebsten unter der Bettdecke kuscheln möchte. Selbst das achtminütige „In The Morning“ wirkt in diesem Kontext vollkommen schlüssig, ist sogar so schnell vorüber, dass man sich die Augen reibt, in welche Sphären die Digitalanzeige da abhebt. Ansonsten wird jeder Fan akustischer Gitarrenrockklänge in diesem Album eine bodenständige Alternative zur DauerDubSchallung von The Good, The Bad & The Queen finden. Hach, das nennt man dann wohl SchaumSchlagAbtausch auf höchstem Niveau.
Graham Coxon versucht derweil mit seinem neuen Album endlich aus dem übergroßen Schatten von Blur zu treten. „The Spinning Top“ wirkt, als hätten Nick Drake und der großartige Sean Lennon ein entspanntes Dinner vorm Kamin veranstaltet und sich zunehmend von der knisternden Szenerie anstecken lassen. Man kann das Album gut durchlaufen lassen, wenn man sich mal wieder romantisch mit der Liebsten unter der Bettdecke kuscheln möchte. Selbst das achtminütige „In The Morning“ wirkt in diesem Kontext vollkommen schlüssig, ist sogar so schnell vorüber, dass man sich die Augen reibt, in welche Sphären die Digitalanzeige da abhebt. Ansonsten wird jeder Fan akustischer Gitarrenrockklänge in diesem Album eine bodenständige Alternative zur DauerDubSchallung von The Good, The Bad & The Queen finden. Hach, das nennt man dann wohl SchaumSchlagAbtausch auf höchstem Niveau.
 Die Tiny Vipers geben sich derweil alle Mühe, das romantische Treiben weiter fortzusetzen. Gegen ihren Sound mutet Graham Coxons Album allerdings fast schon visionär an. So traditionell wurde schon lange nicht mehr auf der Spielwiese des Folk hin und hergewippt. Man fühlt sich regelrecht in eine karge Landschaft transportiert, die Blätter haben ihren Platz an der Sonne aufgegeben und purzeln hektisch durch eine staubige Szenerie, die einen immer wieder an diese alten Westernschinken erinnert. Die Vipers wollen, dass man es sich auf dem Balkon gemütlich macht, sich eine Zigarette anzündet und einfach mal der Dinge harrt. Sie bestehen regelrecht darauf, dass man sich vollkommen auf die Musik einlässt. Ihre Songs nehmen sich immer eine Spur zu viel Zeit. Und während die ersten schon das Gähnen anfangen, entdecken die Aufmerksamen bezaubernde Melodien, die sich da aus dem Nichts schlängeln. „Life On Earth“ ist wie ein alter, tiefer Brunnen. Je länger man hineinblickt, umso mehr scheinen sich da Umrisse im Reich der Schatten abzuzeichnen.
Die Tiny Vipers geben sich derweil alle Mühe, das romantische Treiben weiter fortzusetzen. Gegen ihren Sound mutet Graham Coxons Album allerdings fast schon visionär an. So traditionell wurde schon lange nicht mehr auf der Spielwiese des Folk hin und hergewippt. Man fühlt sich regelrecht in eine karge Landschaft transportiert, die Blätter haben ihren Platz an der Sonne aufgegeben und purzeln hektisch durch eine staubige Szenerie, die einen immer wieder an diese alten Westernschinken erinnert. Die Vipers wollen, dass man es sich auf dem Balkon gemütlich macht, sich eine Zigarette anzündet und einfach mal der Dinge harrt. Sie bestehen regelrecht darauf, dass man sich vollkommen auf die Musik einlässt. Ihre Songs nehmen sich immer eine Spur zu viel Zeit. Und während die ersten schon das Gähnen anfangen, entdecken die Aufmerksamen bezaubernde Melodien, die sich da aus dem Nichts schlängeln. „Life On Earth“ ist wie ein alter, tiefer Brunnen. Je länger man hineinblickt, umso mehr scheinen sich da Umrisse im Reich der Schatten abzuzeichnen.
 Rinôcérôse wollen derweil am liebsten alles auf einmal. Und zur Unterstützung haben sie eine ganze Reihe von Gaststars eingeladen, die ihrem galaktischen Treiben auf „Futurinô“ das passende Gesangs-Outfit verleihen. Der Musik tut dieser Abwechslungsreichtum zunehmend gut. Vor allem Luke Paterson und Ninja vom Go! Team machen eine passable Figur. Zudem klingt die Scheibe so ein bisschen, als hätte Moby wieder Ideen für die Tanzfläche und Daft Punk sich nicht in einem nostalgischen Schleier verfangen. Man kann gar nicht genug betonen, wie schweißtreibend diese Stücke einen mit zunehmendem Anstieg des Lautstärkepegels um die eigene Achse rotieren lassen. Fast meint man, Chikinki hätten wieder in die Spur zurück gefunden, wenn einem Mark Gardener („Where You From?“) und Bnann („Head Like A Volcano“) die schönsten Hüftschwinger seit Justice um die Ohren ballern. Wer ein puristisches Elektrowerk erwartet hatte, muss bis zum Nachfolger warten. Rinôcérôse sind im Pop angekommen. Und yep: es steht ihnen gut, das neue Glitzeroutfit.
Rinôcérôse wollen derweil am liebsten alles auf einmal. Und zur Unterstützung haben sie eine ganze Reihe von Gaststars eingeladen, die ihrem galaktischen Treiben auf „Futurinô“ das passende Gesangs-Outfit verleihen. Der Musik tut dieser Abwechslungsreichtum zunehmend gut. Vor allem Luke Paterson und Ninja vom Go! Team machen eine passable Figur. Zudem klingt die Scheibe so ein bisschen, als hätte Moby wieder Ideen für die Tanzfläche und Daft Punk sich nicht in einem nostalgischen Schleier verfangen. Man kann gar nicht genug betonen, wie schweißtreibend diese Stücke einen mit zunehmendem Anstieg des Lautstärkepegels um die eigene Achse rotieren lassen. Fast meint man, Chikinki hätten wieder in die Spur zurück gefunden, wenn einem Mark Gardener („Where You From?“) und Bnann („Head Like A Volcano“) die schönsten Hüftschwinger seit Justice um die Ohren ballern. Wer ein puristisches Elektrowerk erwartet hatte, muss bis zum Nachfolger warten. Rinôcérôse sind im Pop angekommen. Und yep: es steht ihnen gut, das neue Glitzeroutfit.
 Kylie Auldist gibt sich derweil auf „Made Of Stone“ alle Mühe, den harten Kern in ihrem Inneren mit einer musikalischen Offenbarung zu kontern. Jazz, Pop und Funk gehen hier eine charmante Liaison ein. Die Soulsängerin aus Australien reiht sich mit ihrem Sound neben Amy Winehouse und Konsorten ein, kann aber als Bonus für sich verbuchen, dass ihre Songs auch abseits des ganzen Showbusiness Geplänkels Bestand haben. Gerade zu diesem Zeitpunkt, wo ein Retro-Funk-Backlash kurz bevor steht, ist Kyle Auldist ein imposanter Entwurf gelungen, bei dem sie zeitgenössischen Jazz mit einer verrauchten Stimme kontert, ohne als Abziehbild der Großen im Geschäft zu enden. „Made Of Stone“ hat so viel Herz, dass man jede harte Schale damit zum Schmelzen bringt. Vom Radiohörer zum Jazzclub-Gänger dürfte sich jeder auf diesen Sound einigen können. Kylie Auldist sollte nur aufpassen, dass sie sich in Zukunft nicht noch weiter in Richtung Radiopop entwickelt. Dann könnte die beschwingte Attitüde dieses Albums schnell im Einheitsbrei versinken. Womit wir es dann auch mal wieder gut sein lassen für heute. Genießt die Sonne. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Kylie Auldist gibt sich derweil auf „Made Of Stone“ alle Mühe, den harten Kern in ihrem Inneren mit einer musikalischen Offenbarung zu kontern. Jazz, Pop und Funk gehen hier eine charmante Liaison ein. Die Soulsängerin aus Australien reiht sich mit ihrem Sound neben Amy Winehouse und Konsorten ein, kann aber als Bonus für sich verbuchen, dass ihre Songs auch abseits des ganzen Showbusiness Geplänkels Bestand haben. Gerade zu diesem Zeitpunkt, wo ein Retro-Funk-Backlash kurz bevor steht, ist Kyle Auldist ein imposanter Entwurf gelungen, bei dem sie zeitgenössischen Jazz mit einer verrauchten Stimme kontert, ohne als Abziehbild der Großen im Geschäft zu enden. „Made Of Stone“ hat so viel Herz, dass man jede harte Schale damit zum Schmelzen bringt. Vom Radiohörer zum Jazzclub-Gänger dürfte sich jeder auf diesen Sound einigen können. Kylie Auldist sollte nur aufpassen, dass sie sich in Zukunft nicht noch weiter in Richtung Radiopop entwickelt. Dann könnte die beschwingte Attitüde dieses Albums schnell im Einheitsbrei versinken. Womit wir es dann auch mal wieder gut sein lassen für heute. Genießt die Sonne. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
UND WAS NUN?