Wenn Karin Dreijer Andersson von den lieb gewonnenen The Knife ein Soloprojekt aus dem Boden hievt, dann starren alle wie gebannt in ihre Richtung. Schließlich hat sie eine der verzauberndsten und gleichzeitig verstörendsten Stimmen unserer Zeit. Mit dem namenlosen Werk ihres verhallten Elektro-Projektes Fever Ray verliert sie sich zunehmend in fast selbst zerstörerischen Momenten, die eine Erhabenheit ausstrahlen, die man so im Pop lange nicht gesehen hat. Ihre Songs sind von einer solchen Ehrlichkeit und Hingabe gekennzeichnet, dass man zwischenzeitlich fast das Gefühl bekommt, man müsse sie vor sich selbst schützen. Hat man sich dann erstmal zurecht gefunden, ist der Weg zum aktuellen Material von The Knife gar nicht mehr so weit. Schon mit ihrer Hauptband hat sie sich auf ihrem letzten Album ja eher den abseitigen Gefilden zugewandt. Mit Fever Ray steuert Miss Andersson nun geradewegs dem Abgrund entgegen. Der Sprung über die Klippen endet allerdings nicht in einem flammenden Inferno. Stattdessen verharren die Klänge im Raum, so als könnte sie sich über den Moment und die Zeit hinweg setzen und einfach abheben. Ein atemberaubendes Werk. Formvollendet. Fast schon majestätisch. Man möchte es all den Plastikpuppen im Popgeschäft einfach nur mit voller Kraft vor die Füße schmettern.
Und hey… was haben sich die französischen Weltenbummler von Phoenix denn nur dabei gedacht? Sind die jetzt unter die Nostalgiker gegangen oder warum schwelgen sie auf ihrem „Kitsune Tabloid“-Sampler in solch romantischen Erinnerungen. Die süßesten Versuchungen der letzten 50 Jahre wurden da aufs Tablett gehievt und charmant zu einem wohlschmeckenden Büffet zusammengemischt. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Das hier ist keinesfalls ein neues Update dieser unsäglichen Fetenhits-Sampler, die immer wieder die gleichen Songs im neuen Look aneinander reihen. Diese Sammlung besticht vor allem dadurch, dass auf offensichtliche Knaller über weite Strecken verzichtet wird. Stattdessen bezaubern einen Kiss, Elvis Costello & The Attractions, Lou Reed, Dennis Wilson, Roxy Music und Iggy Pop mit zwar nicht gänzlich unbekannten, aber doch in letzter Zeit nur selten vernommenen Klängen ihres musikalischen Gemischtwarenladens. Dass die Übergänge dabei manchmal etwas holprig geraten – macht ja nix, weil die Songs einfach allesamt so hoffnungslos romantisch stimmen, dass man kurzerhand aufs nächste Häuserdach spurtet, um sich einen Moment der Ruhe zu gönnen. Diese Musik ist wie geschaffen, um über den Dächern der Stadt von Heldentaten zu träumen. So, als würde der kleine Superheld in jedem von uns durch den Zauber der Musik von einem bunten Umhang umschlungen.
Die Jungs von Straight Frank klettern da hinterher lieber in rockige Gefilde. Und man ist sich nicht so ganz sicher, ob diese Hook-lastige Hommage an Acts, wie Kiss und Whitesnake sich nicht alleine deshalb disqualifiziert, weil das alles so verflucht retro klingt, dass nicht mal mehr Guns´n´Roses damit durchkommen dürften. Trotzdem strotzt „And We Walked By With A Bag Full Of Money…” von vorne bis hinten vor Hits, die sich geradezu aufdrängen, im nächsten Guitar Hero Game platziert zu werden. Alles in allem also der perfekte Soundtrack für alle, die immer noch selbst verliebt mit der Mähne im Takt wippen. Ich persönlich halte es da schon eher wie MC Lars: „Playing Guitar Hero Doesn´t Mean You Play Guitar.“
Und jetzt nur schnell weg in Richtung Scraps Of Tape. Die spielen nicht nur am 22.05.2009 im Jugendkulturhaus Cairo in Würzburg, die erzeugen mit ihren atmosphärischen Klängen auch einen wohligen Schauer sanfter Melancholie. Dass über all dem eine geradezu bezaubernde Stimme thront. Umso besser. Die Postrocker verstehen es auf jeden Fall das Antlitz der Sonne mit einer Schar dunkler Wolkenformationen zurück zu schlagen. Und dürften mit ihrem Album „Grand Letdown“ bald zu den Lieblingen der Szene zählen. Auf ihrem dritten Album taumeln die Trauerklösse aus Schweden dabei durch ein verregnetes Szenario, das jeder Film Noir-Ästhetik alle Ehre macht. Man ist geradezu hingerissen von der Wucht der Songs, die niemals Gefahr laufen, an den hochgesteckten Ambitionen zu zerbrechen. Am Ende entspringt daraus ein reißender Wasserfall an Melodien, dem man sich nur zu gerne ausliefert. Also mitreißen lassen und hinterher mal nachgeschaut, was die zahllosen Mitglieder der Broken Social Scene so treiben.
Die sind ja nie verlegen darum, ein weiteres musikalisches Schmankerl aufs Tablett zu zaubern. Doch Charles Spearin erprobt sich auf seinem Solowerk „The Happiness Project“ zumindest zu Beginn an solch absurden Collagen von Stimmen, dass man sich vom anschließenden Pianokracher „Anna“ trotz eines verqueren Themas fast schon wohlig in die Arme genommen fühlt. Anschließend folgen dann noch Bläser und allerhand sprachliche Absurditäten, die es erstmal zu dechiffrieren gilt. Alles in allem ein äußerst ambitionierter Sidekick bei dem man aufpassen sollte, dass man keine Seitenstiche bekommt. Diese Songs und Tracks fordern einen in einem dermaßen hohen Maße, dass manch einer vielleicht dazu neigen könnte, die Vokabel „erschöpfend“ auf die Musik anzuwenden. Wieder andere finden das dann einfach „spannend“. Ich favorisiere „something outta space“.
Und schleich mal weiter in Richtung Land Of Kush. Die machen da weiter, wo der liebe Charles aufgehört hat, verzieren das Ganze allerdings noch mit allerhand spacigen Sounds und Klangeffekten. „Against The Day“ ist dabei von der ersten Garde des Postrocks zusammengeschraubt. Ein 30köpfiges Ensemble bestehend aus Mitgliedern von Silver Mt. Zion und Godspeed You! Black Emporer wurde angekarrt und darf sich an epischen Jam-Sessions mit orientalischen Ansätzen abarbeiten. Hat man sich allerdings erstmal eingehört, entpuppt sich das chaotische Durcheinander als bunte Spielwiese für Freunde der improvisierten Klänge. Ein Hauch von Jazz liegt in der Luft, der in den verrauchten Wänden eines Kellerclubs für angenehme Atmosphäre sorgen soll. Schade nur, dass das Ganze dabei manchmal etwas aus dem Ruder läuft.
NeunundzwanzigMinutenUndDreißigSekunden. So viel Zeit benötigen hinterher The Rakes, um sich zum zweiten Mal in die Herzen all derer zu spielen, die immer noch ins Schwärmen geraten, wenn sie an das Debüt von Franz Ferdinand denken. „Klang“ heißt nun das dritte Werk dieser hierzulande so schmerzlich unterschätzten Band und ich kann es gar nicht laut genug sagen: die Jungs haben wieder in die Erfolgsspur zurück gefunden. Die Scheibe läuft geradezu über vor Hits (nicht so, wie der blutleere Vorgänger). Hier weiß man gar nicht, wo man zuerst hin skippen soll. Der Tanzflächenhüpfer „That´s The Reason“, die erste Single „1989“, das schmissige „The Loneliness Of The Outdoor Smoker“, das hymnische “Shackelton”. Man möchte sich sofort die Kleider vom Leib reißen und einen Nackt-Salto in den Pool hinlegen. Und wenn man dann nach Verklingen des letzten Tons langsam wieder in der Realität ankommt. Dann wäre da ja immer noch die Repeat-Taste des Cd-Players um die Partysause auf Endlosschleife zu schalten. Das mit Sicherheit schönste Tanzflächenalbum des Frühlings. Da schaut sogar die letzte Franz Ferdinand blöd aus der Wäsche.
Noch schweißtreibender wird es hinterher auf dem neuen Album von Miss Kittin & The Hacker. Auf „Two“ ballert sich das Produzentenduo Caroline Hervé und Michel Amato durch ein synthetisches Cyber-Pop-Universum, dass man sich fühlt, als würde man in einer verpixelten C64-Rakete sitzen und mit aufopferungsvoller Hingabe die Welt vor dem Untergang bewahren. Jedenfalls schnurrt die Musik aufreizend, wie ein kleines Kätzchen auf Süßigkeiten-Jagd und gibt sich auch nicht damit zufrieden, lediglich die elektronischen Klischees zu bedienen. Stattdessen surfen die Tracks immer wieder gekonnt durch abseitige Gefilde im weiten Raum des Alls umher und wagen kleine Abstecher in 80er Jahre Disco-Phantasien der Marke Blondie. Wenn dazu dann noch ein staubtrockener Synthie-Beat durch den Raum jagt, reißt man als Hörer nur noch freudig die Arme in die Luft und feiert den Moment. Ein durch und durch gelungenes Elektrowerk, das wir jetzt mal mit einer dicken Portion klassischen HipHop kontern.
Die Firma hat nämlich mal wieder einen Rundumschlag gestartet. Diesmal gibt’s allerdings wirklich nur das Gelbe vom Ei. Auf „Gesammelte Werke – Hits und Raritäten aus den Jahren 1998 – 2008“ versammeln Tatwaffe, Fader Gladiator und Def Benski alle Hits ihrer Karriere auf zwei randvollen Silberlingen. Mir persönlich taugt dabei immer noch das alte Zeug (mit freundlicher Unterstützung von Curse, Torch oder Creuzfeld & Jakob) am besten. Gerade um die Jahrtausendwende haben die Jungs einen Kracher nach dem anderen raus gehauen. „Die Eine“, „Kap der guten Hoffnung“ und „Aktionäre“ gehören zum Besten, was deutscher HipHop jemals hervorgebracht hat. Komplettiert wird das ganze dann von den zahlreichen Hits nach dem Hype. „Spiel des Lebens“, „Glücksprinzip“ und natürlich „Die Eine 2005“. Da lacht das HipHop-Herz. Also Daumen hoch für die insgesamt 40 Hits, die das Trio aus Köln hier angekarrt hat. Checkt es aus.
Und wer sich hinterher dann vollends die Dröhnung verabreichen will, der sollte sich mal das neue Album von Roland Meyer de Voltaire reinziehen. Auf „Das letzte bisschen Etikette“ sucht er sein Heil mal wieder im verstrahlten Kosmos pianistischer Absurditäten, so dass man meint, Thom Yorke hätte gerade einen Deutschkurs absolviert. Wenn sich nach knapp zweieinhalb Minuten die Stimme des Sängers zum ersten Mal über die Musik erhebt, reißt er einen plötzlich aus allen Träumen und donnert mit einem impulsiven Schwerenöter von Riff direkt ins „prockige“ Herz des Zeitgeistes. Diese Musik ist schlicht unfassbar. Und schlendert gerade deswegen auch in ihren poppigen Momenten, wo man sonst nur allzu oft Kalkül vermutet, scheinbar spielend am Massengeschmack vorbei. „Warum fühl ich mich so scheiße, warum seit ihr alle so still?“ heißt es im zweiten Song und man fühlt diesen sanften Geist einer Band wie Muse in die Musik kriechen. Nur ohne Stadion. Ohne Lichteffekte. Die Musik scheint hingebungsvoll verwebt in der überbordenden Produktion. Spätestens in „Die Gute Art“ wird das Ganze dann auch noch politisch, weshalb ich ihnen den letzten Rest meiner Sympathie zu Füßen werfe und mich ehrfürchtig vor diesem Album verneige.
Anschließend kümmern wir uns dann mal wieder um durchgeknallte Elektroklänge. Bronnt Industries Kapital entwerfen auf ihrem Album „Hard For Justice“ mysteriös schimmernde Elektronika-Sounds, die von klassischen Horrorfilmen beeinflusst sind. So „als beschalle der englische Poet Wilfred Owen die Tanzfläche eines Kerkers mit Diskomusik“ heißt es im Platteninfo der Band. Und der Gedanke ist gar nicht mal so abwegig. Bei Tracknamen, wie „Threnody For The Victims Of Lucio Fulci“ bleibt kein Laken trocken. Stattdessen meuchelt sich der liebe Nick Talbot von Gravenhurst mit dem Gitarristen von War Against Sleep Guy Bartell durch ein verstörend schönes Elektrowerk, das wie geschaffen ist zur nächsten Horror-Party im Hintergrund des Raumes zu verhallen, wie die Schreie eines verzweifelten Opfers.
Zum Abschluss noch ein kleiner Abstecher zu den Melancholikern von Sue. Die sind erst vor kurzem auf Numero Uno in den Myspace-Charts gegangen. Und wollen es jetzt auch im wirklichen Leben wissen. „Home Philosophy“ schimpft sich ihr Debütalbum. Und manche Songs verdienen wirklich das Etikett außerordentlich. Etwas schade nur, dass die Produktion so dermaßen großspurig geraten ist. Viele der Stücke hätten das gar nicht nötig gehabt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier Produzentengrößen, wie Matthias Arfmann (Jan Delay, Beginner, Patrice) und Swen Meyer (Kettcar, Tomte) am Start waren. Alles in allem kann man so liebevolle Schmachtfetzen, wie „Hamburg Is The Love“, aber immer noch ganz eng an sich drücken. Liebhaben. Durchknuddeln. Und Slut haben ihren Zenith ja auch nicht gleich mit dem Debüt erklommen. Insgesamt ein vielleicht zu diesem Zeitpunkt etwas überambitioniertes Werk, dessen Nachfolger geradewegs durch die Decke gehen könnte. Und wie jetzt? Hör ich da jemand „klingt ja wie Polarkreis 18“ brüllen? Glaubt ihm kein Wort. Die Musik steht für sich selbst. Und „Sad Place“ ist jetzt schon ein sicherer Anwärter für alle Indie-Discotheken der Nation. Also einfach mal wieder feiern gehen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
 Wenn Karin Dreijer Andersson von den lieb gewonnenen The Knife ein Soloprojekt aus dem Boden hievt, dann starren alle wie gebannt in ihre Richtung. Schließlich hat sie eine der verzauberndsten und gleichzeitig verstörendsten Stimmen unserer Zeit. Mit dem namenlosen Werk ihres verhallten Elektro-Projektes
Wenn Karin Dreijer Andersson von den lieb gewonnenen The Knife ein Soloprojekt aus dem Boden hievt, dann starren alle wie gebannt in ihre Richtung. Schließlich hat sie eine der verzauberndsten und gleichzeitig verstörendsten Stimmen unserer Zeit. Mit dem namenlosen Werk ihres verhallten Elektro-Projektes  Und hey… was haben sich die französischen Weltenbummler von Phoenix denn nur dabei gedacht? Sind die jetzt unter die Nostalgiker gegangen oder warum schwelgen sie auf ihrem „Kitsune Tabloid“-Sampler in solch romantischen Erinnerungen. Die süßesten Versuchungen der letzten 50 Jahre wurden da aufs Tablett gehievt und charmant zu einem wohlschmeckenden Büffet zusammengemischt. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Das hier ist keinesfalls ein neues Update dieser unsäglichen Fetenhits-Sampler, die immer wieder die gleichen Songs im neuen Look aneinander reihen. Diese Sammlung besticht vor allem dadurch, dass auf offensichtliche Knaller über weite Strecken verzichtet wird. Stattdessen bezaubern einen Kiss, Elvis Costello & The Attractions, Lou Reed, Dennis Wilson, Roxy Music und Iggy Pop mit zwar nicht gänzlich unbekannten, aber doch in letzter Zeit nur selten vernommenen Klängen ihres musikalischen Gemischtwarenladens. Dass die Übergänge dabei manchmal etwas holprig geraten – macht ja nix, weil die Songs einfach allesamt so hoffnungslos romantisch stimmen, dass man kurzerhand aufs nächste Häuserdach spurtet, um sich einen Moment der Ruhe zu gönnen. Diese Musik ist wie geschaffen, um über den Dächern der Stadt von Heldentaten zu träumen. So, als würde der kleine Superheld in jedem von uns durch den Zauber der Musik von einem bunten Umhang umschlungen.
Und hey… was haben sich die französischen Weltenbummler von Phoenix denn nur dabei gedacht? Sind die jetzt unter die Nostalgiker gegangen oder warum schwelgen sie auf ihrem „Kitsune Tabloid“-Sampler in solch romantischen Erinnerungen. Die süßesten Versuchungen der letzten 50 Jahre wurden da aufs Tablett gehievt und charmant zu einem wohlschmeckenden Büffet zusammengemischt. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Das hier ist keinesfalls ein neues Update dieser unsäglichen Fetenhits-Sampler, die immer wieder die gleichen Songs im neuen Look aneinander reihen. Diese Sammlung besticht vor allem dadurch, dass auf offensichtliche Knaller über weite Strecken verzichtet wird. Stattdessen bezaubern einen Kiss, Elvis Costello & The Attractions, Lou Reed, Dennis Wilson, Roxy Music und Iggy Pop mit zwar nicht gänzlich unbekannten, aber doch in letzter Zeit nur selten vernommenen Klängen ihres musikalischen Gemischtwarenladens. Dass die Übergänge dabei manchmal etwas holprig geraten – macht ja nix, weil die Songs einfach allesamt so hoffnungslos romantisch stimmen, dass man kurzerhand aufs nächste Häuserdach spurtet, um sich einen Moment der Ruhe zu gönnen. Diese Musik ist wie geschaffen, um über den Dächern der Stadt von Heldentaten zu träumen. So, als würde der kleine Superheld in jedem von uns durch den Zauber der Musik von einem bunten Umhang umschlungen. Die Jungs von
Die Jungs von  Und jetzt nur schnell weg in Richtung
Und jetzt nur schnell weg in Richtung  Die sind ja nie verlegen darum, ein weiteres musikalisches Schmankerl aufs Tablett zu zaubern. Doch
Die sind ja nie verlegen darum, ein weiteres musikalisches Schmankerl aufs Tablett zu zaubern. Doch  Und schleich mal weiter in Richtung Land Of Kush. Die machen da weiter, wo der liebe Charles aufgehört hat, verzieren das Ganze allerdings noch mit allerhand spacigen Sounds und Klangeffekten. „Against The Day“ ist dabei von der ersten Garde des Postrocks zusammengeschraubt. Ein 30köpfiges Ensemble bestehend aus Mitgliedern von Silver Mt. Zion und Godspeed You! Black Emporer wurde angekarrt und darf sich an epischen Jam-Sessions mit orientalischen Ansätzen abarbeiten. Hat man sich allerdings erstmal eingehört, entpuppt sich das chaotische Durcheinander als bunte Spielwiese für Freunde der improvisierten Klänge. Ein Hauch von Jazz liegt in der Luft, der in den verrauchten Wänden eines Kellerclubs für angenehme Atmosphäre sorgen soll. Schade nur, dass das Ganze dabei manchmal etwas aus dem Ruder läuft.
Und schleich mal weiter in Richtung Land Of Kush. Die machen da weiter, wo der liebe Charles aufgehört hat, verzieren das Ganze allerdings noch mit allerhand spacigen Sounds und Klangeffekten. „Against The Day“ ist dabei von der ersten Garde des Postrocks zusammengeschraubt. Ein 30köpfiges Ensemble bestehend aus Mitgliedern von Silver Mt. Zion und Godspeed You! Black Emporer wurde angekarrt und darf sich an epischen Jam-Sessions mit orientalischen Ansätzen abarbeiten. Hat man sich allerdings erstmal eingehört, entpuppt sich das chaotische Durcheinander als bunte Spielwiese für Freunde der improvisierten Klänge. Ein Hauch von Jazz liegt in der Luft, der in den verrauchten Wänden eines Kellerclubs für angenehme Atmosphäre sorgen soll. Schade nur, dass das Ganze dabei manchmal etwas aus dem Ruder läuft.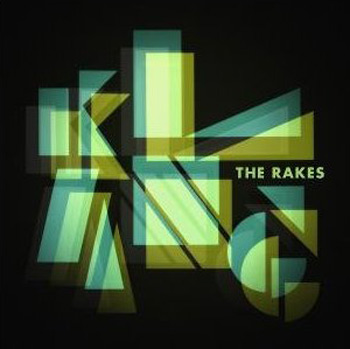 NeunundzwanzigMinutenUndDreißigSekunden. So viel Zeit benötigen hinterher
NeunundzwanzigMinutenUndDreißigSekunden. So viel Zeit benötigen hinterher  Noch schweißtreibender wird es hinterher auf dem neuen Album von
Noch schweißtreibender wird es hinterher auf dem neuen Album von 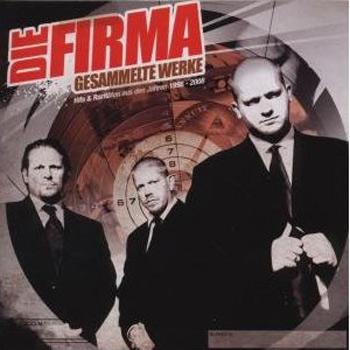
 Und wer sich hinterher dann vollends die Dröhnung verabreichen will, der sollte sich mal das neue Album von Roland Meyer de
Und wer sich hinterher dann vollends die Dröhnung verabreichen will, der sollte sich mal das neue Album von Roland Meyer de  Anschließend kümmern wir uns dann mal wieder um durchgeknallte Elektroklänge.
Anschließend kümmern wir uns dann mal wieder um durchgeknallte Elektroklänge. 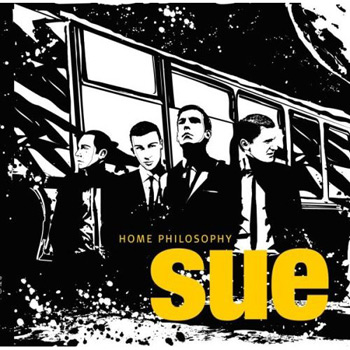 Zum Abschluss noch ein kleiner Abstecher zu den Melancholikern von Sue. Die sind erst vor kurzem auf Numero Uno in den Myspace-Charts gegangen. Und wollen es jetzt auch im wirklichen Leben wissen. „Home Philosophy“ schimpft sich ihr Debütalbum. Und manche Songs verdienen wirklich das Etikett außerordentlich. Etwas schade nur, dass die Produktion so dermaßen großspurig geraten ist. Viele der Stücke hätten das gar nicht nötig gehabt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier Produzentengrößen, wie Matthias Arfmann (Jan Delay, Beginner, Patrice) und Swen Meyer (Kettcar, Tomte) am Start waren. Alles in allem kann man so liebevolle Schmachtfetzen, wie „Hamburg Is The Love“, aber immer noch ganz eng an sich drücken. Liebhaben. Durchknuddeln. Und Slut haben ihren Zenith ja auch nicht gleich mit dem Debüt erklommen. Insgesamt ein vielleicht zu diesem Zeitpunkt etwas überambitioniertes Werk, dessen Nachfolger geradewegs durch die Decke gehen könnte. Und wie jetzt? Hör ich da jemand „klingt ja wie Polarkreis 18“ brüllen? Glaubt ihm kein Wort. Die Musik steht für sich selbst. Und „Sad Place“ ist jetzt schon ein sicherer Anwärter für alle Indie-Discotheken der Nation. Also einfach mal wieder feiern gehen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Zum Abschluss noch ein kleiner Abstecher zu den Melancholikern von Sue. Die sind erst vor kurzem auf Numero Uno in den Myspace-Charts gegangen. Und wollen es jetzt auch im wirklichen Leben wissen. „Home Philosophy“ schimpft sich ihr Debütalbum. Und manche Songs verdienen wirklich das Etikett außerordentlich. Etwas schade nur, dass die Produktion so dermaßen großspurig geraten ist. Viele der Stücke hätten das gar nicht nötig gehabt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier Produzentengrößen, wie Matthias Arfmann (Jan Delay, Beginner, Patrice) und Swen Meyer (Kettcar, Tomte) am Start waren. Alles in allem kann man so liebevolle Schmachtfetzen, wie „Hamburg Is The Love“, aber immer noch ganz eng an sich drücken. Liebhaben. Durchknuddeln. Und Slut haben ihren Zenith ja auch nicht gleich mit dem Debüt erklommen. Insgesamt ein vielleicht zu diesem Zeitpunkt etwas überambitioniertes Werk, dessen Nachfolger geradewegs durch die Decke gehen könnte. Und wie jetzt? Hör ich da jemand „klingt ja wie Polarkreis 18“ brüllen? Glaubt ihm kein Wort. Die Musik steht für sich selbst. Und „Sad Place“ ist jetzt schon ein sicherer Anwärter für alle Indie-Discotheken der Nation. Also einfach mal wieder feiern gehen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?