 Dass ich das noch erleben darf. Die Arctic Monkeys haben sich doch tatsächlich selbst als Motiv für ihr neues Frontcover ausgewählt. Das zeugt von gestiegenem Selbstbewusstsein, dass sich auch in den aktuellen Songs wider spiegelt. Die Scheibe beginnt zwar noch relativ erwartungsgemäß mit einem zurückgelehnten Smasher namens „My Propeller“, dann allerdings wird’s gefährlich. „Crying Lightning“ ist sicherlich kein offensichtlicher Anwärter für eine Single-Auskopplung gewesen. Die Jungs haben es trotzdem ausgekoppelt. Und siehe da: nach zwanzig Durchläufen entpuppt sich das Teil als einer der größten Hits der Bandgeschichte. Der Rest des Albums zeigt eine Band auf der Suche nach sich selbst. Es wird einfach mal unerforschtes Gebiet beackert. Dass sie damit durchkommen, liegt vorwiegend daran, dass sich hinter den schief gestimmten Gitarren immer wieder astreine Popsongs verstecken. „Dangerous Animals“, „Secret Door“, „Potion Approaching“, „Cornerstone“ und „Dance Little Liar“ – allesamt Hits für die Ewigkeit. Den Rest der Scheibe nimmt man so mit. Erfreut sich an der ungestümen Attitüde von „Pretty Visitors“ und schmachtet zu Alison Mossharts (The Kills) Background-Gesang auf „Fire And The Thud“ vollends dahin. Kurz darauf ist dann schon wieder alles vorbei. Zeit für einen neuen Durchlauf. Mit „Humbug“ halten die Monkeys ihr eigenes Feuer am laufen. Und mit dem nächsten Album sollten sie dann vollends in Richtung Rockolymp aufsteigen. Dann nämlich werden sie mit ziemlicher Sicherheit ihren Stil gefunden haben, was wiederum nur eines bedeuten kann: wir haben einen Klassiker zu erwarten.
Dass ich das noch erleben darf. Die Arctic Monkeys haben sich doch tatsächlich selbst als Motiv für ihr neues Frontcover ausgewählt. Das zeugt von gestiegenem Selbstbewusstsein, dass sich auch in den aktuellen Songs wider spiegelt. Die Scheibe beginnt zwar noch relativ erwartungsgemäß mit einem zurückgelehnten Smasher namens „My Propeller“, dann allerdings wird’s gefährlich. „Crying Lightning“ ist sicherlich kein offensichtlicher Anwärter für eine Single-Auskopplung gewesen. Die Jungs haben es trotzdem ausgekoppelt. Und siehe da: nach zwanzig Durchläufen entpuppt sich das Teil als einer der größten Hits der Bandgeschichte. Der Rest des Albums zeigt eine Band auf der Suche nach sich selbst. Es wird einfach mal unerforschtes Gebiet beackert. Dass sie damit durchkommen, liegt vorwiegend daran, dass sich hinter den schief gestimmten Gitarren immer wieder astreine Popsongs verstecken. „Dangerous Animals“, „Secret Door“, „Potion Approaching“, „Cornerstone“ und „Dance Little Liar“ – allesamt Hits für die Ewigkeit. Den Rest der Scheibe nimmt man so mit. Erfreut sich an der ungestümen Attitüde von „Pretty Visitors“ und schmachtet zu Alison Mossharts (The Kills) Background-Gesang auf „Fire And The Thud“ vollends dahin. Kurz darauf ist dann schon wieder alles vorbei. Zeit für einen neuen Durchlauf. Mit „Humbug“ halten die Monkeys ihr eigenes Feuer am laufen. Und mit dem nächsten Album sollten sie dann vollends in Richtung Rockolymp aufsteigen. Dann nämlich werden sie mit ziemlicher Sicherheit ihren Stil gefunden haben, was wiederum nur eines bedeuten kann: wir haben einen Klassiker zu erwarten.
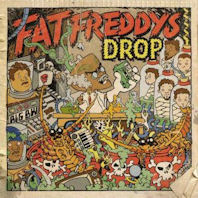 Und jetzt mal Ohren gespitzt: Vorsicht Geheimtipp. Es gibt nämlich kaum jemanden, den Fat Freddys Drop mit ihrer zurückgelehnten Attitüde nicht schon von sich überzeugt hätten, wenn ihre Sounds zum ersten Mal die Gehörgänge durchfluteten. Auf dem lang ersehnten neuen Album „Dr Boondigga & The Big BW“ gibt es nun erneut eine ganze Reihe entspannte Soul- und Reggae-Märchen, die man sich am besten bei sanftem Kerzenlicht oder beim Engtanz im verrauchten Club zu Gemüte führt. Schön zu sehen, dass die Jungs auch diesmal nicht davon abgesehen haben, zu improvisieren. Auf charttechnische Formatradiokacke wird gepfiffen. Stattdessen frönen die Neuseeländer dem Jazz und genießen die Freiheit, die sie sich mit dem grandiosen Vorgänger erspielt haben. In diesem Album manifestiert sich ein Freiheitsdenken, dass leider viel zu vielen Künstlern heutzutage abgeht. Dementsprechend begebt euch doch mal auf eine Testfahrt mit diesem inspirativen Experimentierkasten. Ich garantiere euch, ihr werdet überrascht sein.
Und jetzt mal Ohren gespitzt: Vorsicht Geheimtipp. Es gibt nämlich kaum jemanden, den Fat Freddys Drop mit ihrer zurückgelehnten Attitüde nicht schon von sich überzeugt hätten, wenn ihre Sounds zum ersten Mal die Gehörgänge durchfluteten. Auf dem lang ersehnten neuen Album „Dr Boondigga & The Big BW“ gibt es nun erneut eine ganze Reihe entspannte Soul- und Reggae-Märchen, die man sich am besten bei sanftem Kerzenlicht oder beim Engtanz im verrauchten Club zu Gemüte führt. Schön zu sehen, dass die Jungs auch diesmal nicht davon abgesehen haben, zu improvisieren. Auf charttechnische Formatradiokacke wird gepfiffen. Stattdessen frönen die Neuseeländer dem Jazz und genießen die Freiheit, die sie sich mit dem grandiosen Vorgänger erspielt haben. In diesem Album manifestiert sich ein Freiheitsdenken, dass leider viel zu vielen Künstlern heutzutage abgeht. Dementsprechend begebt euch doch mal auf eine Testfahrt mit diesem inspirativen Experimentierkasten. Ich garantiere euch, ihr werdet überrascht sein.
 Die RX Bandits haben derweil schon viel zu lange ein Dasein im Untergrund gefristet. Zumindest hierzulande ist ihr Name nur ein paar nimmermüden Sublime-Anhängern ein Begriff, die händeringend das Loch in ihrem Herzen zu füllen versuchen. Das mit dem Bekanntheitsgrad könnte sich nun allerdings ändern, denn das neue Album „Mandala“ erscheint ganz offiziell auch in hiesigen Breitengraden. Darauf schreitet die Incubus-Werdung der Band weiter voran, die Gruppe findet zudem zurück zu alter Stärke. Vor lauter Ambitionen hatten sie auf den beiden Vorläufern nämlich hin und wieder den Song aus den Augen verloren. Im Gegensatz dazu finden sich auf „Mandala“ zehn Tracks, die allesamt zum entspannten Wippen auf der Hängematte und gleichermaßen zum Luftgitarrenwettbewerb in einer Schlammgrube anregen. Die Gitarren klingen zwar nicht mehr ganz so locker flockig beschwingt, wie früher – auf Bläser wird gleich ganz verzichtet, dafür haut einem die Band aber die E-Gitarren mit einer gehörigen Portion Schmackes um die Ohren. Wer die Bandits bisher noch nicht für sich entdecken durfte, sollte das nun nachholen. Besonders zu empfehlen in diesem Zusammenhang auch die tolle Scheibe „Progress“ aus dem Jahre 2001.
Die RX Bandits haben derweil schon viel zu lange ein Dasein im Untergrund gefristet. Zumindest hierzulande ist ihr Name nur ein paar nimmermüden Sublime-Anhängern ein Begriff, die händeringend das Loch in ihrem Herzen zu füllen versuchen. Das mit dem Bekanntheitsgrad könnte sich nun allerdings ändern, denn das neue Album „Mandala“ erscheint ganz offiziell auch in hiesigen Breitengraden. Darauf schreitet die Incubus-Werdung der Band weiter voran, die Gruppe findet zudem zurück zu alter Stärke. Vor lauter Ambitionen hatten sie auf den beiden Vorläufern nämlich hin und wieder den Song aus den Augen verloren. Im Gegensatz dazu finden sich auf „Mandala“ zehn Tracks, die allesamt zum entspannten Wippen auf der Hängematte und gleichermaßen zum Luftgitarrenwettbewerb in einer Schlammgrube anregen. Die Gitarren klingen zwar nicht mehr ganz so locker flockig beschwingt, wie früher – auf Bläser wird gleich ganz verzichtet, dafür haut einem die Band aber die E-Gitarren mit einer gehörigen Portion Schmackes um die Ohren. Wer die Bandits bisher noch nicht für sich entdecken durfte, sollte das nun nachholen. Besonders zu empfehlen in diesem Zusammenhang auch die tolle Scheibe „Progress“ aus dem Jahre 2001.
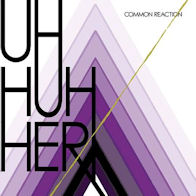 Uh Huh Her sind mit reichlich Verspätung nun auch hierzulande aufgeschlagen. Mit ihren elektronischen Soundwalzen und weiblichem Gesang, der sich das Beste von den Sugababes und Girls Aloud klaut und daraus ein paar echte musikalische Arschtritte formuliert, dürften sie schon bald als die schönste Versuchung seit den unsäglichen t.a.t.u. gelten. Mit diesem Album werden allerdings auch diejenigen glücklich werden, die sich vor geraumer Zeit mal zur Disco-Phase von Garbage die Haken abtanzten. „Common Reaction“ knallt so charmant und atemlos rein, dass man sich von Songs, wie „Explode“ und dem etwas gemächlicheren „Say So“ nur zu gerne an der Nase herumführen lässt. Gegen Ende geht der Scheibe dann zwar leider etwas die Puste aus, aber da ist man eh schon im siebten Himmel der Glückseligkeit. Mit etwas Glück wird man in ein paar Jahren bei Uh Huh Her nicht mehr nur an eine schöne Platte von PJ Harvey denken. Man wird sich daran erinnern, dass Popmusik auch Spaß bereiten kann, ohne sich gängigen Klischees anzubiedern. Diese Band hier ist der lebende Beweis dafür.
Uh Huh Her sind mit reichlich Verspätung nun auch hierzulande aufgeschlagen. Mit ihren elektronischen Soundwalzen und weiblichem Gesang, der sich das Beste von den Sugababes und Girls Aloud klaut und daraus ein paar echte musikalische Arschtritte formuliert, dürften sie schon bald als die schönste Versuchung seit den unsäglichen t.a.t.u. gelten. Mit diesem Album werden allerdings auch diejenigen glücklich werden, die sich vor geraumer Zeit mal zur Disco-Phase von Garbage die Haken abtanzten. „Common Reaction“ knallt so charmant und atemlos rein, dass man sich von Songs, wie „Explode“ und dem etwas gemächlicheren „Say So“ nur zu gerne an der Nase herumführen lässt. Gegen Ende geht der Scheibe dann zwar leider etwas die Puste aus, aber da ist man eh schon im siebten Himmel der Glückseligkeit. Mit etwas Glück wird man in ein paar Jahren bei Uh Huh Her nicht mehr nur an eine schöne Platte von PJ Harvey denken. Man wird sich daran erinnern, dass Popmusik auch Spaß bereiten kann, ohne sich gängigen Klischees anzubiedern. Diese Band hier ist der lebende Beweis dafür.
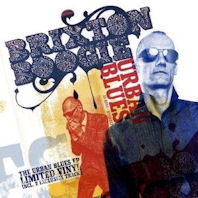 „Urban Blues“ fabriziert derweil der Hamburger Musiker und Produzent Krisz Kreuzer alias Brixtonboogie und dockt damit direkt an der Stelle an, wo Gnarls Barkley und The Roots schon vor einigen Jahren an Land gingen und die Clubs stürmten. Irgendwo im Grenzgebiet zwischen Soul und HipHop kämpfen schicke Melodien um die Vorherrschaft und dürften in jeder Funk- and Soul-Disco auf offene Ohren stoßen. Der Popappeal der Scheibe wurde dabei exakt so hoch gehalten, dass die Stücke zwar charmant anmuten, aber niemals zu gleichförmig wirken. Ansonsten gibt es stilistisch eigentlich keine großen Beschränkungen. Ein bisschen Reggaeromantik, ein wenig 60s-Atmosphäre, eine Portion Blues und eine Prise Funk. Mundet alles ganz vorzüglich und sorgt bisweilen auch für die passende romantische Atmosphäre im Rahmen eines ausgedehnten Kuschelabends.
„Urban Blues“ fabriziert derweil der Hamburger Musiker und Produzent Krisz Kreuzer alias Brixtonboogie und dockt damit direkt an der Stelle an, wo Gnarls Barkley und The Roots schon vor einigen Jahren an Land gingen und die Clubs stürmten. Irgendwo im Grenzgebiet zwischen Soul und HipHop kämpfen schicke Melodien um die Vorherrschaft und dürften in jeder Funk- and Soul-Disco auf offene Ohren stoßen. Der Popappeal der Scheibe wurde dabei exakt so hoch gehalten, dass die Stücke zwar charmant anmuten, aber niemals zu gleichförmig wirken. Ansonsten gibt es stilistisch eigentlich keine großen Beschränkungen. Ein bisschen Reggaeromantik, ein wenig 60s-Atmosphäre, eine Portion Blues und eine Prise Funk. Mundet alles ganz vorzüglich und sorgt bisweilen auch für die passende romantische Atmosphäre im Rahmen eines ausgedehnten Kuschelabends.
 Dial M For Murder! wirken derweil nicht nur vom Look her, wie ein Update der lebenden Toten von Joy Division. Gerade deshalb fällt es nicht leicht, ihr erstes Album „Fiction Of Her Dreams“ objektiv zu bewerten. Im Endeffekt könnte das Werk nämlich auch ein neues Album von Interpol oder den Editors sein. Da stimmt einfach alles. Sogar die Songs sind dermaßen klasse, dass man sich dazu in den Indie-Discos der Nation dreht und windet, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit ein weiterer musikalischer Entwurf in diese Richtung heutzutage wirklich noch nötig ist. Wer der indielastigen Düsternis zugeneigt ist, wird in diesem Album einen treuen Freund finden. Alle anderen sollten sich im Zweifelsfall lieber an die Originale halten. Vorausgesetzt natürlich sie haben deren musikalischen Output nicht sowieso schon komplett im Schrank stehen.
Dial M For Murder! wirken derweil nicht nur vom Look her, wie ein Update der lebenden Toten von Joy Division. Gerade deshalb fällt es nicht leicht, ihr erstes Album „Fiction Of Her Dreams“ objektiv zu bewerten. Im Endeffekt könnte das Werk nämlich auch ein neues Album von Interpol oder den Editors sein. Da stimmt einfach alles. Sogar die Songs sind dermaßen klasse, dass man sich dazu in den Indie-Discos der Nation dreht und windet, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit ein weiterer musikalischer Entwurf in diese Richtung heutzutage wirklich noch nötig ist. Wer der indielastigen Düsternis zugeneigt ist, wird in diesem Album einen treuen Freund finden. Alle anderen sollten sich im Zweifelsfall lieber an die Originale halten. Vorausgesetzt natürlich sie haben deren musikalischen Output nicht sowieso schon komplett im Schrank stehen.
 Cable wiederum streifen den Songs ihres neuen Albums „The Failed Convict“ ein übergeordnetes Konzept auf und ich muss zugeben: ich hab schon Schlechteres gehört. Eine Flucht aus dem Knast wird vertont in dreizehn Passagen und klingt soundmäßig in etwa so, als hätte man in einer Whiskey-Bar einen Mikroständer aufgestellt und ein paar tätowierte Recken zum Jammen eingeladen. Kurz gesagt: Cable sind das etwas breitbeinigere Gegenstück zu den Jungs von Fucked Up. Ein imposanter Haufen ambitionierter Musiker, denen der ganze Screamo-Hype völlig am Arsch vorbei geht. Gut so. Schickes Artwork noch dazu, auch wenn mir selbiges leider nicht in seiner Endform vorliegt…
Cable wiederum streifen den Songs ihres neuen Albums „The Failed Convict“ ein übergeordnetes Konzept auf und ich muss zugeben: ich hab schon Schlechteres gehört. Eine Flucht aus dem Knast wird vertont in dreizehn Passagen und klingt soundmäßig in etwa so, als hätte man in einer Whiskey-Bar einen Mikroständer aufgestellt und ein paar tätowierte Recken zum Jammen eingeladen. Kurz gesagt: Cable sind das etwas breitbeinigere Gegenstück zu den Jungs von Fucked Up. Ein imposanter Haufen ambitionierter Musiker, denen der ganze Screamo-Hype völlig am Arsch vorbei geht. Gut so. Schickes Artwork noch dazu, auch wenn mir selbiges leider nicht in seiner Endform vorliegt…
 Ebenso bemerkenswert. Ein Benefiz Sampler aus dem Hause Mark Mulcahy zugunsten seiner kürzlich verstorbenen Ehefrau. Der Sänger war Mitglied der College-Rocker Miracle Legion und der Combo Polaris und stand bereits mit Jeff Buckley und Oasis auf der Bühne. Nun wurde ein Mixtape zusammen gestellt, das sich sehen lassen kann. Thom Yorke (covert hier einen Song von Mulcahy selbst) ist ebenso am Start wie Michael Stipe und Dinosaur Jr. Dazu gibt’s reichlich Material von The National, Ben Kweller, dem wunderbaren Frank Turner, Mercury Rev, Frank Black, Vic Chesnutt und zahlreichen anderen. Die vertretenen Tracks sind dabei weit mehr, als Ausschussware. Man möchte sich einfach nur zurücklehnen und genießen. Kann man sich ein besseres Ende für einen Zuckerbeat vorstellen? Natürlich nicht. Dementsprechend macht es mal gut. Bis zum nächsten Mal.
Ebenso bemerkenswert. Ein Benefiz Sampler aus dem Hause Mark Mulcahy zugunsten seiner kürzlich verstorbenen Ehefrau. Der Sänger war Mitglied der College-Rocker Miracle Legion und der Combo Polaris und stand bereits mit Jeff Buckley und Oasis auf der Bühne. Nun wurde ein Mixtape zusammen gestellt, das sich sehen lassen kann. Thom Yorke (covert hier einen Song von Mulcahy selbst) ist ebenso am Start wie Michael Stipe und Dinosaur Jr. Dazu gibt’s reichlich Material von The National, Ben Kweller, dem wunderbaren Frank Turner, Mercury Rev, Frank Black, Vic Chesnutt und zahlreichen anderen. Die vertretenen Tracks sind dabei weit mehr, als Ausschussware. Man möchte sich einfach nur zurücklehnen und genießen. Kann man sich ein besseres Ende für einen Zuckerbeat vorstellen? Natürlich nicht. Dementsprechend macht es mal gut. Bis zum nächsten Mal.
UND WAS NUN?