 Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen: Jamie.T Der nächste Star am Indie-Pop-Himmel. Das ist er ja eigentlich schon seit seinem hervorragenden Debüt, das hierzulande leider sang und klanglos unterging, aber jetzt sollte es endlich klappen mit dem großen Wurf. „Kings & Queens“ ist ein einziges Hitfeuerwerk im Grenzgebiet von The Streets, den Beastie Boys und den Arctic Monkeys. Soviel Zeitgeist auf einem Album versammelt: da kann einem beim ersten Durchlauf schon mal schwindelig werden. Nach mehreren Probeläufen stellt sich dann allerdings dasselbe wohlige Gefühl ein, dass einen schon beim Erstling überkam. Die Stücke sind zwar zunehmend poppiger geworden und klingen diesmal mehr nach vollwertigem Song, als nach Jamsession. Trotzdem werden Tracks, wie „Castro Dies“, „British Intelligence“ und „Earth, Wind & Fire“ auch diesmal jede Indie-Disse in eine Kopfnicker-Kneipe transformieren. Kurz gesagt: „Kings & Queens“ ist das schönste Crossover-Album des fortschreitenden Jahres. Ein Platz in den Jahrescharts dürften dem lieben Mr T. mit diesem Mix aus Reggae, Rap, Indiepop und zeitgeistiger Attitüde deshalb schon mal sicher sein.
Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen: Jamie.T Der nächste Star am Indie-Pop-Himmel. Das ist er ja eigentlich schon seit seinem hervorragenden Debüt, das hierzulande leider sang und klanglos unterging, aber jetzt sollte es endlich klappen mit dem großen Wurf. „Kings & Queens“ ist ein einziges Hitfeuerwerk im Grenzgebiet von The Streets, den Beastie Boys und den Arctic Monkeys. Soviel Zeitgeist auf einem Album versammelt: da kann einem beim ersten Durchlauf schon mal schwindelig werden. Nach mehreren Probeläufen stellt sich dann allerdings dasselbe wohlige Gefühl ein, dass einen schon beim Erstling überkam. Die Stücke sind zwar zunehmend poppiger geworden und klingen diesmal mehr nach vollwertigem Song, als nach Jamsession. Trotzdem werden Tracks, wie „Castro Dies“, „British Intelligence“ und „Earth, Wind & Fire“ auch diesmal jede Indie-Disse in eine Kopfnicker-Kneipe transformieren. Kurz gesagt: „Kings & Queens“ ist das schönste Crossover-Album des fortschreitenden Jahres. Ein Platz in den Jahrescharts dürften dem lieben Mr T. mit diesem Mix aus Reggae, Rap, Indiepop und zeitgeistiger Attitüde deshalb schon mal sicher sein.
 Getreu dem Motto: „Hände in die Luft und durch“ schmettern einem Polar Bear Club hinterher dann auf „Chasing Hamburg“ einen emotional rockenden Klangteppich vor die Füße. Die Jungs scheinen in ihre Jugend ziemlich viel Hot Water Music und Samiam gehört zu haben. Jedenfalls knallt ihr neues Werk eben in diese Kerbe, die früher mal als „Emo“ bezeichnet wurde, heute aber vom gleichförmigem Gedudel der Marke Hawthorne Heights und Konsorten mit allerhand Schminke zugekleistert wurde. Jedenfalls: Polar Bear Club sind die Guten. Diejenigen, die verstanden haben, dass eine glatte Produktion keinen guten Song ersetzt. Eine Band, die sich nicht ihrer Ecken und Kanten beraubt, weil sie genau weiß, dass in den musikalischen Widerhaken die Emotionalität der Songs begraben liegt. Man muss eben auch mal gegen eine Wand rennen, um zu sehen, wie schön es ist, eine Ziellinie zu überqueren. Polar Bear Club stolpern deshalb auch mehr hingebungsvoll, als technisch versiert durch ihre Songs. Macht aber nichts, weil ihre Message direkt beim Hörer ankommt. Sie lautet: hier hast du eine halbe Stunde Herzblut, lass es mal wieder ordentlich krachen. Schade nur, dass das alles viel zu schnell vorbei ist. Ich freu mich jedenfalls jetzt schon auf den Nachfolger.
Getreu dem Motto: „Hände in die Luft und durch“ schmettern einem Polar Bear Club hinterher dann auf „Chasing Hamburg“ einen emotional rockenden Klangteppich vor die Füße. Die Jungs scheinen in ihre Jugend ziemlich viel Hot Water Music und Samiam gehört zu haben. Jedenfalls knallt ihr neues Werk eben in diese Kerbe, die früher mal als „Emo“ bezeichnet wurde, heute aber vom gleichförmigem Gedudel der Marke Hawthorne Heights und Konsorten mit allerhand Schminke zugekleistert wurde. Jedenfalls: Polar Bear Club sind die Guten. Diejenigen, die verstanden haben, dass eine glatte Produktion keinen guten Song ersetzt. Eine Band, die sich nicht ihrer Ecken und Kanten beraubt, weil sie genau weiß, dass in den musikalischen Widerhaken die Emotionalität der Songs begraben liegt. Man muss eben auch mal gegen eine Wand rennen, um zu sehen, wie schön es ist, eine Ziellinie zu überqueren. Polar Bear Club stolpern deshalb auch mehr hingebungsvoll, als technisch versiert durch ihre Songs. Macht aber nichts, weil ihre Message direkt beim Hörer ankommt. Sie lautet: hier hast du eine halbe Stunde Herzblut, lass es mal wieder ordentlich krachen. Schade nur, dass das alles viel zu schnell vorbei ist. Ich freu mich jedenfalls jetzt schon auf den Nachfolger.
 Eher konventionell geht’s derweil auf dem neuen Album von Saosin zu. Die wurden ja zu Beginn ihrer Karriere mal als die nächsten Deftones gehandelt. Nun könnten sie im Zuge der Vergoldung zahlreicher Emo-Kapellen in den USA endlich den verdienten Durchbruch erleben. Bitte nicht falsch verstehen: mit so unsäglichem Schminke-Pop der Marke Madina Lake oder Every Avenue haben ihre Songs rein gar nichts am Hut. Stattdessen bietet „In Search Of Solid Ground“ einen ausgewogenen Mix aus raditauglichen Hitsingles und atmosphärischen Klängen, die das Album mit links über die breite Masse der Gleichförmigkeit empor hieven. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil in diesem Zusammenhang ist allerdings die Stimme von Sänger Cove Reber, der hier einem Großteil seiner musikalischen Weggefährten vorführt, wie man seine Emotionen äußerst nachhaltig an den Mann bringt. Wie der Sänger seiner Stimme immer wieder neue Facetten abtrotzt und das ellenlange Abschlussfeuerwerk „Fireflies“ nahezu mit links meistert, wirkt schon ziemlich imposant. Zu den neuen Tool werden Saosin damit noch lange nicht, empfehlen sich aber nachhaltig als Bindeglied der alten Garde zur hippen Gattung der Story Of The Years, Amber Pacifics und so weiter.
Eher konventionell geht’s derweil auf dem neuen Album von Saosin zu. Die wurden ja zu Beginn ihrer Karriere mal als die nächsten Deftones gehandelt. Nun könnten sie im Zuge der Vergoldung zahlreicher Emo-Kapellen in den USA endlich den verdienten Durchbruch erleben. Bitte nicht falsch verstehen: mit so unsäglichem Schminke-Pop der Marke Madina Lake oder Every Avenue haben ihre Songs rein gar nichts am Hut. Stattdessen bietet „In Search Of Solid Ground“ einen ausgewogenen Mix aus raditauglichen Hitsingles und atmosphärischen Klängen, die das Album mit links über die breite Masse der Gleichförmigkeit empor hieven. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil in diesem Zusammenhang ist allerdings die Stimme von Sänger Cove Reber, der hier einem Großteil seiner musikalischen Weggefährten vorführt, wie man seine Emotionen äußerst nachhaltig an den Mann bringt. Wie der Sänger seiner Stimme immer wieder neue Facetten abtrotzt und das ellenlange Abschlussfeuerwerk „Fireflies“ nahezu mit links meistert, wirkt schon ziemlich imposant. Zu den neuen Tool werden Saosin damit noch lange nicht, empfehlen sich aber nachhaltig als Bindeglied der alten Garde zur hippen Gattung der Story Of The Years, Amber Pacifics und so weiter.
 Hinterher darf dann mal wieder metallischen Riffs gefrönt werden, ohne dass man das Gefühl bekommt, hier würden zum x-ten Mal dieselben Klischees durchdekliniert. Blakfish verströmen bei aller Härte eine Emotionalität, die man bei vielen ihrer Weggefährten zunehmend vermisst. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Jungs mehr am Sound von At The Drive-In und Biffy Clyro orientieren, als am gleichförmigen Geknüppel der bunt geschminkten Screamo-Fraktion. Der Arbeitstitel „Champions“ ist dabei übrigens ausdrücklich ironisch gemeint, denn abheben tun hier höchstens die Beinchen der schwitzenden Fanscharen, die auf den Konzerten der Crew bis zur Clubdecke hüpfen. Die brutalen bisweilen wütenden Passagen werden immer wieder gekonnt durch A-Capella Passagen oder atmosphärische Sounds ad absurdum geführt. Da trifft dann im gewissen Maße Minus The Bear auf einen Schulchor. Und yep, da kommen am Ende trotzdem tolle Songs bei raus. Bestes Beispiel dafür: das mitreißende „Your Hair´s Straight But Your Boyfriend Ain´t“. Womit wir dann auch schon beim einzigen Wehrmutstropfen dieses Werks wären. Diese Sache mit den ellenlangen ironisch zu verstehenden Songtiteln, die war spätestens nach dem Erstling von Fall Out Boy schon nicht mehr lustig. Was die songtechnische Qualität von „Champions“ jetzt aber in keiner Weise schmälern soll. Tolles Album.
Hinterher darf dann mal wieder metallischen Riffs gefrönt werden, ohne dass man das Gefühl bekommt, hier würden zum x-ten Mal dieselben Klischees durchdekliniert. Blakfish verströmen bei aller Härte eine Emotionalität, die man bei vielen ihrer Weggefährten zunehmend vermisst. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Jungs mehr am Sound von At The Drive-In und Biffy Clyro orientieren, als am gleichförmigen Geknüppel der bunt geschminkten Screamo-Fraktion. Der Arbeitstitel „Champions“ ist dabei übrigens ausdrücklich ironisch gemeint, denn abheben tun hier höchstens die Beinchen der schwitzenden Fanscharen, die auf den Konzerten der Crew bis zur Clubdecke hüpfen. Die brutalen bisweilen wütenden Passagen werden immer wieder gekonnt durch A-Capella Passagen oder atmosphärische Sounds ad absurdum geführt. Da trifft dann im gewissen Maße Minus The Bear auf einen Schulchor. Und yep, da kommen am Ende trotzdem tolle Songs bei raus. Bestes Beispiel dafür: das mitreißende „Your Hair´s Straight But Your Boyfriend Ain´t“. Womit wir dann auch schon beim einzigen Wehrmutstropfen dieses Werks wären. Diese Sache mit den ellenlangen ironisch zu verstehenden Songtiteln, die war spätestens nach dem Erstling von Fall Out Boy schon nicht mehr lustig. Was die songtechnische Qualität von „Champions“ jetzt aber in keiner Weise schmälern soll. Tolles Album.
 Juli Zeh und Slut balancieren derweil auf ihrem neusten Wurf „Corpus Delicti“ auf dem schmalen Grad zwischen Anspruch und poppigen Arrangements. Schon die vorangestellte „Ansage“ in Form einer Einleitung kann man entweder ironisch überspitzt oder nervig finden. Dann allerdings erklingt das traumhafte „Where´s The Army“ und schon ist man gefesselt. Wäre ja gar nicht nötig gewesen noch mal extra darauf hinzuweisen, dass man doch bitte in sitzender Haltung verharren möge. Die stellt sich ganz von selbst ein bei solch emotionalen Sounds. Im weiteren Verlauf spinnen Autorin und Band ein atmosphärisches Netz und erzählen von einer jungen Heldin namens Mia Moll, die sich aus Liebe zu ihrem Bruder gegen das System auflehnt. Am Ende entspringt daraus ein imponierendes Lehrstück darüber, wie man Sprache gekonnt in einen popmusikalischen Kontext setzt. Und wer wäre da als Band schon besser geeignet gewesen, als Slut, um die bemerkenswerte Heldengeschichte für den Popmusikfan neu aufzuarbeiten und in ein treffendes Licht zu rücken. Wenn schon Hörbücher, dass bitte solche, wie diese: da spürt man in jedem Moment die hoffnungslose Hingabe der Menschen, die im Hintergrund die Fäden in der Hand halten.
Juli Zeh und Slut balancieren derweil auf ihrem neusten Wurf „Corpus Delicti“ auf dem schmalen Grad zwischen Anspruch und poppigen Arrangements. Schon die vorangestellte „Ansage“ in Form einer Einleitung kann man entweder ironisch überspitzt oder nervig finden. Dann allerdings erklingt das traumhafte „Where´s The Army“ und schon ist man gefesselt. Wäre ja gar nicht nötig gewesen noch mal extra darauf hinzuweisen, dass man doch bitte in sitzender Haltung verharren möge. Die stellt sich ganz von selbst ein bei solch emotionalen Sounds. Im weiteren Verlauf spinnen Autorin und Band ein atmosphärisches Netz und erzählen von einer jungen Heldin namens Mia Moll, die sich aus Liebe zu ihrem Bruder gegen das System auflehnt. Am Ende entspringt daraus ein imponierendes Lehrstück darüber, wie man Sprache gekonnt in einen popmusikalischen Kontext setzt. Und wer wäre da als Band schon besser geeignet gewesen, als Slut, um die bemerkenswerte Heldengeschichte für den Popmusikfan neu aufzuarbeiten und in ein treffendes Licht zu rücken. Wenn schon Hörbücher, dass bitte solche, wie diese: da spürt man in jedem Moment die hoffnungslose Hingabe der Menschen, die im Hintergrund die Fäden in der Hand halten.
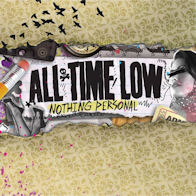 All Time Low geben sich derweil allerhand Mühe, sich mit ihrem neuen Album „Nothing Personal“ aus der breiten Masse der gleichförmigen Pop-Punk Acts zu befreien. Die Scheibe geht gut los. „Weightless“ klingt tatsächlich nach einer potenziellen Hitsingle, die diesen Namen auch verdient hat. Ansonsten orientiert sich die Band vornehmlich am Sound von Blink 182 und macht dabei weniger falsch, als man erwarten durfte. Allein die erste Hälfte des Albums ist eine einzige Ansammlung von Hits für sprungbereite Festivalgänger. All Time Low liefern den perfekten Sound, um von einer Mini-Baggersee-Klippe zu hüpfen, die Beine in die Hand zu nehmen und mit einer fetten Arschbombe einen kurzzeitigen Wellengang zu fabrizieren. Selbigen dürfte es auch auf ihren Konzerten geben. Da werden die Hände reihenweise in die Höhe gerissen werden, wenn diese stadiontauglichen Refrains aus tausenden Kehlen ertönen. Natürlich könnte man auch in diesem Fall wieder anmerken, dass das alles schon in eben dieser Form von einer anderen Kapelle an den Mann gebracht wurde. Spaß macht es trotzdem… und das ist ja die Hauptsache.
All Time Low geben sich derweil allerhand Mühe, sich mit ihrem neuen Album „Nothing Personal“ aus der breiten Masse der gleichförmigen Pop-Punk Acts zu befreien. Die Scheibe geht gut los. „Weightless“ klingt tatsächlich nach einer potenziellen Hitsingle, die diesen Namen auch verdient hat. Ansonsten orientiert sich die Band vornehmlich am Sound von Blink 182 und macht dabei weniger falsch, als man erwarten durfte. Allein die erste Hälfte des Albums ist eine einzige Ansammlung von Hits für sprungbereite Festivalgänger. All Time Low liefern den perfekten Sound, um von einer Mini-Baggersee-Klippe zu hüpfen, die Beine in die Hand zu nehmen und mit einer fetten Arschbombe einen kurzzeitigen Wellengang zu fabrizieren. Selbigen dürfte es auch auf ihren Konzerten geben. Da werden die Hände reihenweise in die Höhe gerissen werden, wenn diese stadiontauglichen Refrains aus tausenden Kehlen ertönen. Natürlich könnte man auch in diesem Fall wieder anmerken, dass das alles schon in eben dieser Form von einer anderen Kapelle an den Mann gebracht wurde. Spaß macht es trotzdem… und das ist ja die Hauptsache.
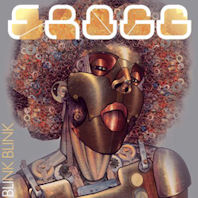 Beim neuen Album von Frogg sollten Seeed-Fans derweil mal genauer hinhören. Mills, die Mitbegründerin der Berliner Tanzparty-Superhelden legt mit „Blink Blink“ in diesen Tagen ihr erstes „Soloalbum“ vor und beeindruckt mit einer imposanten Produktion, die mit dem knallbunten Geknatter der Hautband durchaus mithalten kann. Mills, ihr Partner Mo und DJ Luke, der neben Seeed auch bei Boundzound und den sträflich unterschätzten Moabeat an den Plattentellern dreht, sorgen für einen bunten Strauß zeitgemäßer Tanzflächen-Raketen, die auch im heimischen Wohnzimmer zum schweißtreibenden Herumhopsen anregen. „Blink Blink“ macht dabei nicht den Fehler, sich mit allzu plakativem Konsenspop der amerikanischen Mainstream-Gangart zu begnügen. Dieses Album will den Hörer in Bewegung setzen. Man kann den Zeitgeist regelrecht auf den Bassboxen pulsieren sehen, wenn diese Tracks die Umgebung fluten. Da wäre der verkaufsfördernde Hinweis mit Seeed gar nicht nötig gewesen.
Beim neuen Album von Frogg sollten Seeed-Fans derweil mal genauer hinhören. Mills, die Mitbegründerin der Berliner Tanzparty-Superhelden legt mit „Blink Blink“ in diesen Tagen ihr erstes „Soloalbum“ vor und beeindruckt mit einer imposanten Produktion, die mit dem knallbunten Geknatter der Hautband durchaus mithalten kann. Mills, ihr Partner Mo und DJ Luke, der neben Seeed auch bei Boundzound und den sträflich unterschätzten Moabeat an den Plattentellern dreht, sorgen für einen bunten Strauß zeitgemäßer Tanzflächen-Raketen, die auch im heimischen Wohnzimmer zum schweißtreibenden Herumhopsen anregen. „Blink Blink“ macht dabei nicht den Fehler, sich mit allzu plakativem Konsenspop der amerikanischen Mainstream-Gangart zu begnügen. Dieses Album will den Hörer in Bewegung setzen. Man kann den Zeitgeist regelrecht auf den Bassboxen pulsieren sehen, wenn diese Tracks die Umgebung fluten. Da wäre der verkaufsfördernde Hinweis mit Seeed gar nicht nötig gewesen.
 Die Rockformation Diskokugel hat sich derweil seit ihrem Monsterhit „Mehr Soul“ einen Platz in meinem Herzen reserviert. Direkt neben Superpunk und Konsorten pulsiert ihr Sound so retro-schick vor sich hin, dass man der Crew einen fetten Pokal dafür überreichen möchte, dass sie den Rock und den Roll auch heute noch am Leben erhalten. Ihr neues Album „Zusammen dagegen“ besticht durch ein prolliges schwarz/weiß Cover und wirkt ein wenig, als wollten da ein paar Prügelknaben einen auf dicke Hose machen. Die Scheibe ist dann auch für Diskokugel-Verhältnisse ziemlich rockig geraten. Die ersten beiden Tracks treiben den Schweiß aus den Poren, als wollte man dem Zuhörer einen Wasserfall auf die Stirn pappen. Spätestens mit dem Kinks-mäßigen „All Day And All Of The Night“-Referenzknallbonbon „Wo du hinwillst“ ist man der Band dann aber wieder vollends verfallen. Die Disco wartet. Und wir sind raus für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Die Rockformation Diskokugel hat sich derweil seit ihrem Monsterhit „Mehr Soul“ einen Platz in meinem Herzen reserviert. Direkt neben Superpunk und Konsorten pulsiert ihr Sound so retro-schick vor sich hin, dass man der Crew einen fetten Pokal dafür überreichen möchte, dass sie den Rock und den Roll auch heute noch am Leben erhalten. Ihr neues Album „Zusammen dagegen“ besticht durch ein prolliges schwarz/weiß Cover und wirkt ein wenig, als wollten da ein paar Prügelknaben einen auf dicke Hose machen. Die Scheibe ist dann auch für Diskokugel-Verhältnisse ziemlich rockig geraten. Die ersten beiden Tracks treiben den Schweiß aus den Poren, als wollte man dem Zuhörer einen Wasserfall auf die Stirn pappen. Spätestens mit dem Kinks-mäßigen „All Day And All Of The Night“-Referenzknallbonbon „Wo du hinwillst“ ist man der Band dann aber wieder vollends verfallen. Die Disco wartet. Und wir sind raus für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?