 Hach, schon wieder Herbst geworden. So schnell geht das. Draußen findet man den Fahrradweg nicht mehr, weil alles von gelbem Laub bedeckt ist. Und vielleicht ist das ja ein Sinnbild dafür, dass alles Schöne eben auch immer eine Kehrseite hat. Dass die Zeit des Trubels immer auch eine Zeit des Reflektierens nach sich zieht. Dass man aber auch nur deshalb einen gewissen Schmerz, oder eine bestimmte Sehnsucht nach etwas verspüren kann, weil man eben weiß, dass da noch mehr ist. So sprudelten nach einer ausgedehnten Tournee mit über 600 Shows schließlich auch aus Kevin Devine wieder Songs heraus, die nun in Form des Bastelkastens „Brother´s Blood“ mit Unterstützung des wunderbaren Indie-Label „Arctic Rodeo“ unters Volk gemischt werden. Die Scheibe schlummert auf den ersten Durchlauf noch so vor sich hin, aber spätestens beim dritten Durchgang nimmt einen der Sound dann gefangen. Die zwölf Songs offenbaren sich nicht auf den ersten Blick, entpuppen sich aber als äußerst hartnäckig in Sachen Langlebigkeit. Ich hatte Kevin Devine ja ein wenig aus dem Blickfeld verloren in den letzten Jahren, mit diesem Album allerdings versetzt er mich mal wieder in ungläubiges Staunen. Die Gänsehaut setzt nahezu im Minutentakt ein und wenn er dann „Another Bag Of Bones“ anstimmt und ein famoses „It´s Time Now To Burn“ ins Mikrofon schmettert, ertappt man sich dabei, wie man plötzlich gedankenverloren die Hände in die Luft reißt, um alles in Schutt und Asche zu legen. „Brother´s Blood“ ist Kevin Devines bisher geschlossenstes Werk. Es wandelt auf dem schmalen Grad zwischen Frank Turner, den Get Up Kids und Kings Of Convenience. Es hält die Balance. Am Ende sind dann alle begeistert. Jubel, Trubel, ab dafür: Meine persönliche Herbstplatte des Jahres.
Hach, schon wieder Herbst geworden. So schnell geht das. Draußen findet man den Fahrradweg nicht mehr, weil alles von gelbem Laub bedeckt ist. Und vielleicht ist das ja ein Sinnbild dafür, dass alles Schöne eben auch immer eine Kehrseite hat. Dass die Zeit des Trubels immer auch eine Zeit des Reflektierens nach sich zieht. Dass man aber auch nur deshalb einen gewissen Schmerz, oder eine bestimmte Sehnsucht nach etwas verspüren kann, weil man eben weiß, dass da noch mehr ist. So sprudelten nach einer ausgedehnten Tournee mit über 600 Shows schließlich auch aus Kevin Devine wieder Songs heraus, die nun in Form des Bastelkastens „Brother´s Blood“ mit Unterstützung des wunderbaren Indie-Label „Arctic Rodeo“ unters Volk gemischt werden. Die Scheibe schlummert auf den ersten Durchlauf noch so vor sich hin, aber spätestens beim dritten Durchgang nimmt einen der Sound dann gefangen. Die zwölf Songs offenbaren sich nicht auf den ersten Blick, entpuppen sich aber als äußerst hartnäckig in Sachen Langlebigkeit. Ich hatte Kevin Devine ja ein wenig aus dem Blickfeld verloren in den letzten Jahren, mit diesem Album allerdings versetzt er mich mal wieder in ungläubiges Staunen. Die Gänsehaut setzt nahezu im Minutentakt ein und wenn er dann „Another Bag Of Bones“ anstimmt und ein famoses „It´s Time Now To Burn“ ins Mikrofon schmettert, ertappt man sich dabei, wie man plötzlich gedankenverloren die Hände in die Luft reißt, um alles in Schutt und Asche zu legen. „Brother´s Blood“ ist Kevin Devines bisher geschlossenstes Werk. Es wandelt auf dem schmalen Grad zwischen Frank Turner, den Get Up Kids und Kings Of Convenience. Es hält die Balance. Am Ende sind dann alle begeistert. Jubel, Trubel, ab dafür: Meine persönliche Herbstplatte des Jahres.
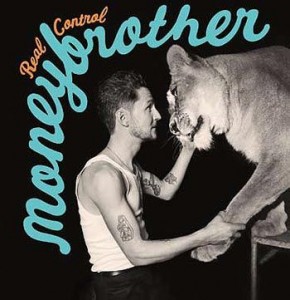 Moneybrother scheint derweil sein Leben als innbrünstiger und hingebungsvoller Soul-Sänger zu vermissen. Die große Bühne, die sein letztes Album ins Auge fasste, hat er jedenfalls erstmal ad acta gelegt. Stattdessen schlendert er mit „Real Control“ zurück in den Club, schnappt sich das Mikro und schmachtet alles in Grund und Boden. Jeder, der ihn einmal live erlebt hat, weiß wovon ich rede. Da schwebst du plötzlich auf Stufe „weiß nicht mehr“ der Emotions-Skala, wenn er ins Mikrofon schluchzt, als wären Schnulzenfilme doch irgendwie geil. Nur übertreibt er es diesmal nicht. Anstatt alles mit einer großen Produktion voll zu kleistern, wird raus gelassen, was auf der Seele liegt. Die Songs gehören zum schmissigsten, was er seit seinem Debüt unters Volk mischte. Sarah Kuttner wird ihm dafür ebenso zu Füßen liegen, wie der Rest der Indie-Gemeinde, der sich fragt, warum diesem Musiker nicht schon lange die ganze Welt um die Zehen krabbelt. Die Antwort gibt Moneybrother auf seinem Album selbst: diese Songs sind kein Futter fürs Formatradio. Die haben Gefühl. Die Scheibe bringt einen dazu im Auto das Luftschlagzeug auszupacken, das Schiebedach zu öffnen und seine Melodien in die Welt hinaus zu schreien. Wäre also gar nicht zu verantworten diesen Sound hier auf die ganze Menschheit loszulassen. Da würde es eh nur Massenkarambolagen geben. Wer trotzdem mal wieder an echten Emotionen lecken möchte. Einen besseren Lolly, als „Real Control“ wird er derzeit nicht finden.
Moneybrother scheint derweil sein Leben als innbrünstiger und hingebungsvoller Soul-Sänger zu vermissen. Die große Bühne, die sein letztes Album ins Auge fasste, hat er jedenfalls erstmal ad acta gelegt. Stattdessen schlendert er mit „Real Control“ zurück in den Club, schnappt sich das Mikro und schmachtet alles in Grund und Boden. Jeder, der ihn einmal live erlebt hat, weiß wovon ich rede. Da schwebst du plötzlich auf Stufe „weiß nicht mehr“ der Emotions-Skala, wenn er ins Mikrofon schluchzt, als wären Schnulzenfilme doch irgendwie geil. Nur übertreibt er es diesmal nicht. Anstatt alles mit einer großen Produktion voll zu kleistern, wird raus gelassen, was auf der Seele liegt. Die Songs gehören zum schmissigsten, was er seit seinem Debüt unters Volk mischte. Sarah Kuttner wird ihm dafür ebenso zu Füßen liegen, wie der Rest der Indie-Gemeinde, der sich fragt, warum diesem Musiker nicht schon lange die ganze Welt um die Zehen krabbelt. Die Antwort gibt Moneybrother auf seinem Album selbst: diese Songs sind kein Futter fürs Formatradio. Die haben Gefühl. Die Scheibe bringt einen dazu im Auto das Luftschlagzeug auszupacken, das Schiebedach zu öffnen und seine Melodien in die Welt hinaus zu schreien. Wäre also gar nicht zu verantworten diesen Sound hier auf die ganze Menschheit loszulassen. Da würde es eh nur Massenkarambolagen geben. Wer trotzdem mal wieder an echten Emotionen lecken möchte. Einen besseren Lolly, als „Real Control“ wird er derzeit nicht finden.
 Und jetzt geht das schon wieder los… dieser Wahnsinn(srapper). Dieser Mädness hat ein zweites Album am Start und die Erwartungen sind immens. Der Vorgänger klang, als wäre deutscher Wortwitz in einen Jungbrunnen gefallen und hätte sich mal so richtig besoffen. Nun also gilt es die Meßlatte im zweiten Anlauf noch eine Stufe höher zu hängen und dem versierten Reimer gelingt das Kunststück locker und flockig die in ihn gesetzten Hoffnungen zu erfüllen. Auf den ersten Blick macht es einem „Zuckerbrot & Peitsche“ zwar ziemlich schwer, aber das bleibt nicht so. Da, wo Mädness den Hörer auf „Unikat“ noch mit offenen Armen entgegen sprang, gewährt sich der Musiker auf dem Zweitling den einen oder anderen Abstecher in verquere Elektrogefilde. Nach und nach schälen sich beim dritten Durchlauf aber doch wieder Reime aus den zerhackten Beats, die ihresgleichen suchen. Kein Wunder, dass da auch Banjo und Savas am Start sind. Wenn Mädness seine Puchlines in die Atmosphäre peitscht, als wolle er dem Rest der Rapgemeinde aufs Brot schmieren, was mit einer großen Portion Talent doch so alles möglich ist, möchte man als Fan des wortwitzigen Treibens auf die Knie fallen, wie Ministranten. Ein imposantes, zweites Album, das den Hörer trotz seiner Lauflänge von 17 Tracks bis zum Ende bei der Stange hält. Gut gemacht.
Und jetzt geht das schon wieder los… dieser Wahnsinn(srapper). Dieser Mädness hat ein zweites Album am Start und die Erwartungen sind immens. Der Vorgänger klang, als wäre deutscher Wortwitz in einen Jungbrunnen gefallen und hätte sich mal so richtig besoffen. Nun also gilt es die Meßlatte im zweiten Anlauf noch eine Stufe höher zu hängen und dem versierten Reimer gelingt das Kunststück locker und flockig die in ihn gesetzten Hoffnungen zu erfüllen. Auf den ersten Blick macht es einem „Zuckerbrot & Peitsche“ zwar ziemlich schwer, aber das bleibt nicht so. Da, wo Mädness den Hörer auf „Unikat“ noch mit offenen Armen entgegen sprang, gewährt sich der Musiker auf dem Zweitling den einen oder anderen Abstecher in verquere Elektrogefilde. Nach und nach schälen sich beim dritten Durchlauf aber doch wieder Reime aus den zerhackten Beats, die ihresgleichen suchen. Kein Wunder, dass da auch Banjo und Savas am Start sind. Wenn Mädness seine Puchlines in die Atmosphäre peitscht, als wolle er dem Rest der Rapgemeinde aufs Brot schmieren, was mit einer großen Portion Talent doch so alles möglich ist, möchte man als Fan des wortwitzigen Treibens auf die Knie fallen, wie Ministranten. Ein imposantes, zweites Album, das den Hörer trotz seiner Lauflänge von 17 Tracks bis zum Ende bei der Stange hält. Gut gemacht.
 Lediglich 13 Songs finden sich hinterher auf „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Orsons“. Und bevor jetzt gleich wieder Fragezeichen im Raum schweben: die Orsons sind so eine Art Supergroup des deutschen HipHop. Der famose Kaas, Plan B, Tua & Maeckes haben sich zusammen getan, um deutschen Rap in die Sesamstraße zu überführen. Musikalisch landet die Scheibe dann im Grenzgebiet von Fettes Brot und K.I.Z., was auch bei Nostalgikern sicher für ein breites Grinsen sorgen dürfte. Wie hier auf alle Konventionen geschissen wird, jegliche Ernsthaftigkeit über Bord geschmissen und Rapmusik in die Dorfdisse überführt wird, da kann man nur sagen: Scheunentor auf und ab dafür. Wir hüpfen durchs Stroh, stecken uns Blümchen ins Haar und feiern das Leben. Der schmale Grad, auf dem die Orsons hier wandeln, ist so wackelig, dass es ein Wunder ist, dass die Band dabei nicht abstürzt. Stellt sich nur die Frage, wie lange dieses süße Wohlgefühl noch anhält. Die „Beatles Piraten“ von 2009 klingen so mitreißend, dass die Euphorie nach kurzer Zeit verschwunden sein könnte. Bis dahin allerdings wird gefeiert: und zwar bis die Schule brennt. Hurra, Hurra.
Lediglich 13 Songs finden sich hinterher auf „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Orsons“. Und bevor jetzt gleich wieder Fragezeichen im Raum schweben: die Orsons sind so eine Art Supergroup des deutschen HipHop. Der famose Kaas, Plan B, Tua & Maeckes haben sich zusammen getan, um deutschen Rap in die Sesamstraße zu überführen. Musikalisch landet die Scheibe dann im Grenzgebiet von Fettes Brot und K.I.Z., was auch bei Nostalgikern sicher für ein breites Grinsen sorgen dürfte. Wie hier auf alle Konventionen geschissen wird, jegliche Ernsthaftigkeit über Bord geschmissen und Rapmusik in die Dorfdisse überführt wird, da kann man nur sagen: Scheunentor auf und ab dafür. Wir hüpfen durchs Stroh, stecken uns Blümchen ins Haar und feiern das Leben. Der schmale Grad, auf dem die Orsons hier wandeln, ist so wackelig, dass es ein Wunder ist, dass die Band dabei nicht abstürzt. Stellt sich nur die Frage, wie lange dieses süße Wohlgefühl noch anhält. Die „Beatles Piraten“ von 2009 klingen so mitreißend, dass die Euphorie nach kurzer Zeit verschwunden sein könnte. Bis dahin allerdings wird gefeiert: und zwar bis die Schule brennt. Hurra, Hurra.
 Und dann weiter gegrinst mit Flight Of The Conchords. Das Duo macht so eine Art Comedy-Elektro-Volksfest-Rap und ist hierzulande wahrscheinlich nur deshalb noch nicht bekannt, weil viele bei ihrem schrägen Wortwitz nicht mehr hinterher kommen. Immer wieder werden hier gekonnt die gängigen Rapklischees durch den Kakao gezogen und Zeilen, wie „These Are The Bulletproof 24-Carat Gold Tears Of A Rapper“ ins Mikrofon gesäuselt. Ja, da möchte man wirklich auf der Stelle losschluchzen. Allerdings stehen einem gleichzeitig die Tränen in den Augen vor Lachen. Das Duo versteht es kongenial, seine Sketsche in Songstrukturen zu überführen, wechselt dann immer wieder spontan auf Spoken Word-Stufe und landet irgendwann wieder im klassischen Songformat. Der Band gelingt es sogar, dass weder die Spontaneität darunter leidet, geschweige denn sich Abnutzungserscheinungen einstellen. Auch wenn die Scheibe niemals ganz den Charme der gleichnamigen TV-Serie erreicht, ist „I Told You I Was Freaky“ trotzdem ein Fest für Freunde des subtilen Humors. So lässt sich auch für Indie-Fans ganz wunderbar auf dicke Hose machen. Zusteigen bitte.
Und dann weiter gegrinst mit Flight Of The Conchords. Das Duo macht so eine Art Comedy-Elektro-Volksfest-Rap und ist hierzulande wahrscheinlich nur deshalb noch nicht bekannt, weil viele bei ihrem schrägen Wortwitz nicht mehr hinterher kommen. Immer wieder werden hier gekonnt die gängigen Rapklischees durch den Kakao gezogen und Zeilen, wie „These Are The Bulletproof 24-Carat Gold Tears Of A Rapper“ ins Mikrofon gesäuselt. Ja, da möchte man wirklich auf der Stelle losschluchzen. Allerdings stehen einem gleichzeitig die Tränen in den Augen vor Lachen. Das Duo versteht es kongenial, seine Sketsche in Songstrukturen zu überführen, wechselt dann immer wieder spontan auf Spoken Word-Stufe und landet irgendwann wieder im klassischen Songformat. Der Band gelingt es sogar, dass weder die Spontaneität darunter leidet, geschweige denn sich Abnutzungserscheinungen einstellen. Auch wenn die Scheibe niemals ganz den Charme der gleichnamigen TV-Serie erreicht, ist „I Told You I Was Freaky“ trotzdem ein Fest für Freunde des subtilen Humors. So lässt sich auch für Indie-Fans ganz wunderbar auf dicke Hose machen. Zusteigen bitte.
 Und alle, die derzeit nur auf Wolke 7 schweben und vor lauter Herzklopfen in Richtung Sternenhimmel abheben. Für all jene sei hier auf Gary Go hingewiesen. Der Newcomer fabriziert elf Songs, als ob es Keane und Konsorten nie gegeben hätte. Das ist das perfekte Futter für vorabendliche Teenie-Soaps. Musik zu der man kotzen möchte oder einen Wasserfall schluchzen – je nach Gemütslage. Songs sieben klingt dann nach Grunge, oder besser: der Song will nach Grunge klingen, klingt aber nach Creed. Der Rest der Scheibe ist Futter fürs Nachmittagsradio. Musik für den neusten Teil der „Alternative Moments“. Elf Hits Schrägstrich Hassobjekte. Je nachdem, was man für einen Standpunkt vertritt, was unter guter Musik zu verstehen ist.
Und alle, die derzeit nur auf Wolke 7 schweben und vor lauter Herzklopfen in Richtung Sternenhimmel abheben. Für all jene sei hier auf Gary Go hingewiesen. Der Newcomer fabriziert elf Songs, als ob es Keane und Konsorten nie gegeben hätte. Das ist das perfekte Futter für vorabendliche Teenie-Soaps. Musik zu der man kotzen möchte oder einen Wasserfall schluchzen – je nach Gemütslage. Songs sieben klingt dann nach Grunge, oder besser: der Song will nach Grunge klingen, klingt aber nach Creed. Der Rest der Scheibe ist Futter fürs Nachmittagsradio. Musik für den neusten Teil der „Alternative Moments“. Elf Hits Schrägstrich Hassobjekte. Je nachdem, was man für einen Standpunkt vertritt, was unter guter Musik zu verstehen ist.
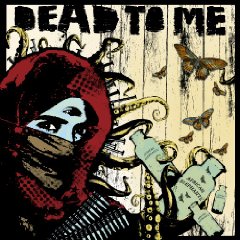 Dead To Me bemühen sich derweil im Opener ihres neuen Albums darum, zurück gelehnte Ska-Klänge mit einer gehörigen Portion punkrockender Schmackes ad absurdum zu führen. Danach darf dann wieder ordentlich gepoltert werden. Hymnisch schlängeln sich die Schenkelklopfer „Modern Muse“ und „Nuthin Runnin Through My Brain“ aus den Boxen. „African Elephants“ ist im weiteren Verlauf ein Album in bester Tradition der alten Scheiben von NoFX und Konsorten. Ein schnörkelloses, aber mit einem Überfluss an tollen Ideen gesegnetes Werk, das aufgrund einiger gekonnter Einfälle (der Auftakt von „A Day Without A War“ ist schlicht famos) nicht Gefahr läuft, die Aufmerksamkeit des Hörers zu „verspielen“. So kann´s weitergehen.
Dead To Me bemühen sich derweil im Opener ihres neuen Albums darum, zurück gelehnte Ska-Klänge mit einer gehörigen Portion punkrockender Schmackes ad absurdum zu führen. Danach darf dann wieder ordentlich gepoltert werden. Hymnisch schlängeln sich die Schenkelklopfer „Modern Muse“ und „Nuthin Runnin Through My Brain“ aus den Boxen. „African Elephants“ ist im weiteren Verlauf ein Album in bester Tradition der alten Scheiben von NoFX und Konsorten. Ein schnörkelloses, aber mit einem Überfluss an tollen Ideen gesegnetes Werk, das aufgrund einiger gekonnter Einfälle (der Auftakt von „A Day Without A War“ ist schlicht famos) nicht Gefahr läuft, die Aufmerksamkeit des Hörers zu „verspielen“. So kann´s weitergehen.
 Marc Hype & Jim Dunloop sorgen derweil dafür, dass sich deine heimische Radioanlage in eine astreine Funkstation verwandelt. Die Betonung liegt hier natürlich auf dem Wort „Funk“, der hier in zehn elektronisch angehauchten Smash-Hits auf den heimischen Tanzboden überführt wird und dafür sorgt, dass die anwesenden Gäste Übungsstunden im Hüftenschwingen absolvieren. Hier wippt jeder mit, ob er möchte oder nicht. „Stamp Out Reality“ fährt einen sofort in die Glieder und sorgt mit seinen zahlreichen Gaststars von Malena Perez über Mr. Lif bis hin zu Flomega und Lady Daisey für einen äußerst abwechslungsreichen Abend. Ein Album zum Durchhören, ohne viel Schnörkel. Auch für Freunde der einschlägigen „Nu Jazz“-Reihen blind zu empfehlen. Womit wir uns mal wieder rar machen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Marc Hype & Jim Dunloop sorgen derweil dafür, dass sich deine heimische Radioanlage in eine astreine Funkstation verwandelt. Die Betonung liegt hier natürlich auf dem Wort „Funk“, der hier in zehn elektronisch angehauchten Smash-Hits auf den heimischen Tanzboden überführt wird und dafür sorgt, dass die anwesenden Gäste Übungsstunden im Hüftenschwingen absolvieren. Hier wippt jeder mit, ob er möchte oder nicht. „Stamp Out Reality“ fährt einen sofort in die Glieder und sorgt mit seinen zahlreichen Gaststars von Malena Perez über Mr. Lif bis hin zu Flomega und Lady Daisey für einen äußerst abwechslungsreichen Abend. Ein Album zum Durchhören, ohne viel Schnörkel. Auch für Freunde der einschlägigen „Nu Jazz“-Reihen blind zu empfehlen. Womit wir uns mal wieder rar machen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?