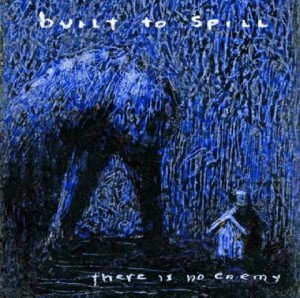 Built To Spill werden wohl auf ewig ein Geheimtipp bleiben. Dabei wissen all die Fans, die sich seit Jahren an den Songs von Death Cab For Cutie und Nada Surf die Seele wärmen, gar nicht, was ihnen entgeht. Hinter dem verzaubernden Artwork versteckt sich ein Melodiereigen irgendwo zwischen Modest Mouse, Superchunk und Teenage Fanclub. Man möchte diese elf Songs einfach nur abfeiern, möchte die alten Scheiben der Lemonheads aus dem Schrank kramen und in nostalgische Gefilde abdriften. Man kann diesen Sound hier sicher altbacken schimpfen, dann müsste man aber auch The Hold Steady und Konsorten verfluchen. Nein, diese Musik ist zeitlos. Nehmen wir zum Beispiel „Hindsight“. Platziert man den Song in einer einschlägigen Vorabendserie, die jungen Leute werden morgen alle in den Plattenladen rennen und sich „There Is No Enemy“ nach Hause holen, die Jalousien nach unten lassen und in diesen Klängen verweilen.
Built To Spill werden wohl auf ewig ein Geheimtipp bleiben. Dabei wissen all die Fans, die sich seit Jahren an den Songs von Death Cab For Cutie und Nada Surf die Seele wärmen, gar nicht, was ihnen entgeht. Hinter dem verzaubernden Artwork versteckt sich ein Melodiereigen irgendwo zwischen Modest Mouse, Superchunk und Teenage Fanclub. Man möchte diese elf Songs einfach nur abfeiern, möchte die alten Scheiben der Lemonheads aus dem Schrank kramen und in nostalgische Gefilde abdriften. Man kann diesen Sound hier sicher altbacken schimpfen, dann müsste man aber auch The Hold Steady und Konsorten verfluchen. Nein, diese Musik ist zeitlos. Nehmen wir zum Beispiel „Hindsight“. Platziert man den Song in einer einschlägigen Vorabendserie, die jungen Leute werden morgen alle in den Plattenladen rennen und sich „There Is No Enemy“ nach Hause holen, die Jalousien nach unten lassen und in diesen Klängen verweilen.
 Owl City klingen auf ihrem Album „Ocean Eyes“ derweil, als hätten sich die Jungs von Fall Out At The Disco einen Drum-Computer gekauft. Schade eigentlich, dass da ständig alles irgendwie mit Effektgeräten verzerrt wird, denn das, was da stimmlich aus den Boxen fließt, würde eigentlich sehr charmant klingen, wenn man als Hörer nicht ständig an Cher und Kanye West denken müsste. Ist wahrscheinlich Geschmacksache, aber mich fällt die Scheibe vor allem aufgrund ihrer glatt gebügelten Produktion zunehmend auf die Nerven. Einzeln auf ein Mixtape platziert, entfalten viele Songs allerdings einen charmanten Emo-Pop-Appeal. Weil es zudem so ist, dass sich Panic At The Disco inzwischen allen synthetischen Klängen verwehren, sollten zumindest deren Hörer mal reinschnuppern. Könnte sich lohnen, vor allem wenn man auf romantische Songs steht, die sich trauen, vollkommen im Kitsch zu versinken.
Owl City klingen auf ihrem Album „Ocean Eyes“ derweil, als hätten sich die Jungs von Fall Out At The Disco einen Drum-Computer gekauft. Schade eigentlich, dass da ständig alles irgendwie mit Effektgeräten verzerrt wird, denn das, was da stimmlich aus den Boxen fließt, würde eigentlich sehr charmant klingen, wenn man als Hörer nicht ständig an Cher und Kanye West denken müsste. Ist wahrscheinlich Geschmacksache, aber mich fällt die Scheibe vor allem aufgrund ihrer glatt gebügelten Produktion zunehmend auf die Nerven. Einzeln auf ein Mixtape platziert, entfalten viele Songs allerdings einen charmanten Emo-Pop-Appeal. Weil es zudem so ist, dass sich Panic At The Disco inzwischen allen synthetischen Klängen verwehren, sollten zumindest deren Hörer mal reinschnuppern. Könnte sich lohnen, vor allem wenn man auf romantische Songs steht, die sich trauen, vollkommen im Kitsch zu versinken.
 Die Dukes Of Windsor aus Australien mühen sich derweil daran ab, elektronische Raffinesse mit Indie-Pop der tanzbaren Sorte zu verknüpfen. Klingt ein bisschen, wie Franz Ferdinand im Disco-Fieber oder wie Chikinki, die einen ähnlichen Ansatz bereits seit einigen Jahren fahren. Die erste Single „It´s A War“ ist so hinreißend, wie kaum ein anderer Track, der heuer die Tanzflächen überflutete. Der Rest des Albums benötigt dem gegenüber zwar ein paar Durchläufe, entwickelt dann aber ein ähnliches Hitpotenzial. „It´s A War“ bietet alles, was ein Chartbreaker so braucht. zuckersüßen Pop mit einer gehörigen Portion fett produzierter Gitarren, Hooklines, die auf Festivals mit geschrieen werden möchten und jede Menge Feinschliff in Sachen Dynamik, so dass man auch beim zehnten Durchlauf noch fröhlich mit pfeift. Die Kaiser Chiefs würden ihr letztes Album wohl am liebsten im Wald verbuddeln, wenn sie einen solchen Schatz an Melodien in der Hinterhand hätten. Bleibt also nur noch abzuwarten, ob die Jungs vielleicht eine Spur zu spät dran sind. Der Hype ist schließlich schon seit Längerem abgeebbt. „It´s The War“ bleibt trotzdem ein tolles Album.
Die Dukes Of Windsor aus Australien mühen sich derweil daran ab, elektronische Raffinesse mit Indie-Pop der tanzbaren Sorte zu verknüpfen. Klingt ein bisschen, wie Franz Ferdinand im Disco-Fieber oder wie Chikinki, die einen ähnlichen Ansatz bereits seit einigen Jahren fahren. Die erste Single „It´s A War“ ist so hinreißend, wie kaum ein anderer Track, der heuer die Tanzflächen überflutete. Der Rest des Albums benötigt dem gegenüber zwar ein paar Durchläufe, entwickelt dann aber ein ähnliches Hitpotenzial. „It´s A War“ bietet alles, was ein Chartbreaker so braucht. zuckersüßen Pop mit einer gehörigen Portion fett produzierter Gitarren, Hooklines, die auf Festivals mit geschrieen werden möchten und jede Menge Feinschliff in Sachen Dynamik, so dass man auch beim zehnten Durchlauf noch fröhlich mit pfeift. Die Kaiser Chiefs würden ihr letztes Album wohl am liebsten im Wald verbuddeln, wenn sie einen solchen Schatz an Melodien in der Hinterhand hätten. Bleibt also nur noch abzuwarten, ob die Jungs vielleicht eine Spur zu spät dran sind. Der Hype ist schließlich schon seit Längerem abgeebbt. „It´s The War“ bleibt trotzdem ein tolles Album.
 The Gilded Palace Of Sin gehen derweil noch eine Spur weiter rein – dorthin wo´s weh tut. Sie machen ihre Sache gut: „You Break Your Hearts, We´ll Tear Yours Out“ schmerzt. Die Platte schluchzt regelrecht. Man hört sie aber trotzdem gern. Obwohl sie einen einlullt mit ihren Streichern und sphärischen Momenten. Irgendwo dazwischen entdeckt man Songs, die etwas bedeuten. Manchmal, wenn die Scheibe aufheult, als wollte man die Welt in Schutt und Asche legen, nur um dann wieder in zärtliche Melancholie zurück zu schwenken, kann man sich nicht zurückhalten und diesen Meter weiter, den die Band verwehrt, einfach für sich selbst gehen. Dann sitzt man plötzlich wieder inmitten der alten Möbel und es erfüllt einen mit Glück, dass da noch Klänge geschaffen werden, die nicht dazu gemacht sind, im digitalen Wegwerfspeicher auf verstaubten Festplatten ein lebloses Dasein zu fristen. Das hier sprengt einem den digitalen Schutzmantel vom Körper. Neben The Builders & The Butchers die bisweilen schönste Alternative für alle, denen die Kings Of Leon so langsam gleichgültig werden.
The Gilded Palace Of Sin gehen derweil noch eine Spur weiter rein – dorthin wo´s weh tut. Sie machen ihre Sache gut: „You Break Your Hearts, We´ll Tear Yours Out“ schmerzt. Die Platte schluchzt regelrecht. Man hört sie aber trotzdem gern. Obwohl sie einen einlullt mit ihren Streichern und sphärischen Momenten. Irgendwo dazwischen entdeckt man Songs, die etwas bedeuten. Manchmal, wenn die Scheibe aufheult, als wollte man die Welt in Schutt und Asche legen, nur um dann wieder in zärtliche Melancholie zurück zu schwenken, kann man sich nicht zurückhalten und diesen Meter weiter, den die Band verwehrt, einfach für sich selbst gehen. Dann sitzt man plötzlich wieder inmitten der alten Möbel und es erfüllt einen mit Glück, dass da noch Klänge geschaffen werden, die nicht dazu gemacht sind, im digitalen Wegwerfspeicher auf verstaubten Festplatten ein lebloses Dasein zu fristen. Das hier sprengt einem den digitalen Schutzmantel vom Körper. Neben The Builders & The Butchers die bisweilen schönste Alternative für alle, denen die Kings Of Leon so langsam gleichgültig werden.
 Von dem lyrischen Genie David Foster Wallace, der leider vor 15 Monaten den Kampf gegen seine Depressionen verlor und dessen Mammut-Manifest „Infinite Jest“ (Unendlicher Spaß) im letzten Jahr alle Kritiker- und Lesercharts anführte, erscheint nun posthuman ein weiterer Sammelband mit zahlreichen Kurzgeschichten des Autors. „In alter Vertrautheit“ ist die Fortsetzung des bereits erhältlichen Sammelbandes „Vergessenheit“, der mit bisweilen analytischer Schlitzohrigkeit den Medien in die Parade fuhr, um einem das eine oder andere Paradox unserer modernen Welt aufs Brot zu schmieren. David Wallace Foster scheint ein Schleier zu umgeben, aus dem es kein Entrinnen gibt. Wenn er in der gleichnamigen Kurzgeschichte des ersten Bands „Vergessenheit“ mit Zeilen nach dem Leser wirft, wie „Meine Frau ist mir fremd geworden. Sie behauptet mein Wachsein besser beurteilen zu können, als ich selbst. Das ist weniger ungerecht als vielmehr völlig verrückt“, muss man sich ducken, um sich mit beiden Handf
Von dem lyrischen Genie David Foster Wallace, der leider vor 15 Monaten den Kampf gegen seine Depressionen verlor und dessen Mammut-Manifest „Infinite Jest“ (Unendlicher Spaß) im letzten Jahr alle Kritiker- und Lesercharts anführte, erscheint nun posthuman ein weiterer Sammelband mit zahlreichen Kurzgeschichten des Autors. „In alter Vertrautheit“ ist die Fortsetzung des bereits erhältlichen Sammelbandes „Vergessenheit“, der mit bisweilen analytischer Schlitzohrigkeit den Medien in die Parade fuhr, um einem das eine oder andere Paradox unserer modernen Welt aufs Brot zu schmieren. David Wallace Foster scheint ein Schleier zu umgeben, aus dem es kein Entrinnen gibt. Wenn er in der gleichnamigen Kurzgeschichte des ersten Bands „Vergessenheit“ mit Zeilen nach dem Leser wirft, wie „Meine Frau ist mir fremd geworden. Sie behauptet mein Wachsein besser beurteilen zu können, als ich selbst. Das ist weniger ungerecht als vielmehr völlig verrückt“, muss man sich ducken, um sich mit beiden Handf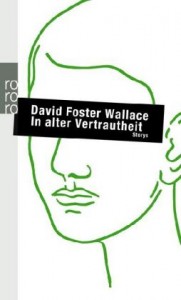 lächen des festen Bodens unter den Füßen zu versichern, der einem bisher immer so guten Halt geboten hatte. David Wallace Foster kehrt den Lauf der Dinge einfach um. Wer behauptet denn eigentlich, dass wir sind, was man uns zuschreibt? Wird der Handelnde nicht seit jeher bestimmt durch das, was er tut und nicht durch das, was er zu sein scheint. Im Rahmen seiner beiden Romane wirft er zahlreiche Fragen dieser Art auf. Im zweiten Band „In alter Vertrautheit“ nimmt er den gesellschaftlichen Konsens auseinander, wie Lego-Teile. hinterfragt, wo Sicherheit herrscht. Er macht es einem nicht unbedingt leicht, wenn er zum Beispiel eine Konferenz beschreibt und dabei alles in winzig kleine Teile zerbröselt, was sich so abspielt, sorgt aber mit seiner analytischen, (un)freiweillig witzigen, bisweilen philosophischen Sprache dafür, dass man ihm regelrecht aus der Hand frisst. Wer Antworten sucht, wird hier keine finden. David Wallace Fosters Kurzgeschichte wollen unsere Grundfeste erschüttern. Das war schon im Sammelband „Kleines Mädchen mit komischen Haaren“ so, wo er in einer Geschichte unser maskenhaftes Dasein mit der Wirklichkeit konfrontiert und so eine Beziehung an nur einem Nachmittag zum Pulverfass mutieren lässt. Das Ende bleibt offen. Wirklich schade, dass wir in Zukunft auf weitere Geschichten dieses brillanten Autors verzichten müssen.
lächen des festen Bodens unter den Füßen zu versichern, der einem bisher immer so guten Halt geboten hatte. David Wallace Foster kehrt den Lauf der Dinge einfach um. Wer behauptet denn eigentlich, dass wir sind, was man uns zuschreibt? Wird der Handelnde nicht seit jeher bestimmt durch das, was er tut und nicht durch das, was er zu sein scheint. Im Rahmen seiner beiden Romane wirft er zahlreiche Fragen dieser Art auf. Im zweiten Band „In alter Vertrautheit“ nimmt er den gesellschaftlichen Konsens auseinander, wie Lego-Teile. hinterfragt, wo Sicherheit herrscht. Er macht es einem nicht unbedingt leicht, wenn er zum Beispiel eine Konferenz beschreibt und dabei alles in winzig kleine Teile zerbröselt, was sich so abspielt, sorgt aber mit seiner analytischen, (un)freiweillig witzigen, bisweilen philosophischen Sprache dafür, dass man ihm regelrecht aus der Hand frisst. Wer Antworten sucht, wird hier keine finden. David Wallace Fosters Kurzgeschichte wollen unsere Grundfeste erschüttern. Das war schon im Sammelband „Kleines Mädchen mit komischen Haaren“ so, wo er in einer Geschichte unser maskenhaftes Dasein mit der Wirklichkeit konfrontiert und so eine Beziehung an nur einem Nachmittag zum Pulverfass mutieren lässt. Das Ende bleibt offen. Wirklich schade, dass wir in Zukunft auf weitere Geschichten dieses brillanten Autors verzichten müssen.
 Quasi wiederum können und wollen sich nicht so richtig entscheiden, wo die Reise denn nun hingehen soll. Die Band taumelt. Zu fallen droht sie nicht. Die Songs ihres Albums „American Gong“ hüpfen galant von einer Spielwiese zur Nächsten und purzeln so famos aus den Boxen, dass schöne Erinnerungen an Pavement und Konsorten wach werden. Auf der Scheibe treffen poppige Arrangements auf psychedelische Breitseiten aufeinander. Der Hörer wird auf Reise geschickt. Die Gitarren werden mal gezupft, mal verprügelt. Der ganz normale Indie-Rock-Wahnsinn eben, wie man es von einem Trio aus Oregon auch erwartet, dem kürzlich noch dazu Bassistin Joanna Bolme von Stephen Malkmus himself beigetreten ist. Zerrissene Jeans aus der Kiste kramen und Regler rauf. Es darf mal wieder so richtig schön abgedreht werden.
Quasi wiederum können und wollen sich nicht so richtig entscheiden, wo die Reise denn nun hingehen soll. Die Band taumelt. Zu fallen droht sie nicht. Die Songs ihres Albums „American Gong“ hüpfen galant von einer Spielwiese zur Nächsten und purzeln so famos aus den Boxen, dass schöne Erinnerungen an Pavement und Konsorten wach werden. Auf der Scheibe treffen poppige Arrangements auf psychedelische Breitseiten aufeinander. Der Hörer wird auf Reise geschickt. Die Gitarren werden mal gezupft, mal verprügelt. Der ganz normale Indie-Rock-Wahnsinn eben, wie man es von einem Trio aus Oregon auch erwartet, dem kürzlich noch dazu Bassistin Joanna Bolme von Stephen Malkmus himself beigetreten ist. Zerrissene Jeans aus der Kiste kramen und Regler rauf. Es darf mal wieder so richtig schön abgedreht werden.
 Turin Brakes hatte ich derweil schon fast wieder abgeschrieben, doch dann schlurfen die plötzlich mit einem charmanten Brit-Pop-Werk um die Ecke, der alle glücklich machen dürfte, deren verzückte Melodievorstellungen noch irgendwo in den 90ern verharren. Die bisweilen akustischen Klampfer, angereichert mit ein paar bezaubernden Melodien der Post-Badly Drawn Boy-Ära, nur mit etwas mehr Schmackes, sorgen für romantische Stimmung, obwohl man doch eigentlich dachte, dass einem dieser Faible für schluchzenden Indie-Pop, schon von den üblichen Verdächtigen der Marke Snow Patrol und Keane vollends ausgetrieben wurde. Turin Brakes betreiben auf „Outbursts“ Exorzismus in Vollendung. Plötzlich ergibt all das Geheule und Schmachten wieder Sinn. Plötzlich fühlt man sich zehn Jahre zurück versetzt und man fragt sich, wie einem diese Jungs hier nur so lange abhanden kommen konnten.
Turin Brakes hatte ich derweil schon fast wieder abgeschrieben, doch dann schlurfen die plötzlich mit einem charmanten Brit-Pop-Werk um die Ecke, der alle glücklich machen dürfte, deren verzückte Melodievorstellungen noch irgendwo in den 90ern verharren. Die bisweilen akustischen Klampfer, angereichert mit ein paar bezaubernden Melodien der Post-Badly Drawn Boy-Ära, nur mit etwas mehr Schmackes, sorgen für romantische Stimmung, obwohl man doch eigentlich dachte, dass einem dieser Faible für schluchzenden Indie-Pop, schon von den üblichen Verdächtigen der Marke Snow Patrol und Keane vollends ausgetrieben wurde. Turin Brakes betreiben auf „Outbursts“ Exorzismus in Vollendung. Plötzlich ergibt all das Geheule und Schmachten wieder Sinn. Plötzlich fühlt man sich zehn Jahre zurück versetzt und man fragt sich, wie einem diese Jungs hier nur so lange abhanden kommen konnten.
 Zum Abschluss noch ein kleines rundum-morbid-Paket aus dem Hause Blutjungs. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich ihr erstes Album damals gefeiert habe, wie kaum ein anderes. Horrorpunk-Rock der Marke „Spielplatzmörder“, „Mama“ oder „Friss dein Brett“ gehören für mich in eine Reihe gestellt mit allem, was die Ärzte so „Ab 18“ produziert haben. Die folgenden Alben konnten daran leider nicht so recht anknüpfen, aber immerhin warfen sie die eine oder andere Perle ab, die sich jeder Fan des kruden Humors unbedingt zu Gemüte führen sollte. Am Besten auf „Godzilla auf Speed“ funktionieren dann wieder die Stücke, die nicht so gewollt wirken. Der Opener „Mädchen mit zwei Köpfen“ ist ähnlich, wie „Monster aus der grünen Lagune“ vom Vorgänger eine Hymne vor dem Herrn. „Punkrocksongapparat“ nimmt gekonnt die ganzen Klischee-Punks aufs Korn und „Jungs Junge“ versteht sich als kongeniale Antwort auf Farins „Jungs“, nur dass die Blutjungs das ganze einfach umdrehen und die Eltern den Rebellen und das Kind den Spießer gibt. Wenn bei euch immer noch regelmäßig die alten Ärzte-Scheiben laufen, schnappt euch diese Scheibe. Es lohnt sich. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
Zum Abschluss noch ein kleines rundum-morbid-Paket aus dem Hause Blutjungs. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich ihr erstes Album damals gefeiert habe, wie kaum ein anderes. Horrorpunk-Rock der Marke „Spielplatzmörder“, „Mama“ oder „Friss dein Brett“ gehören für mich in eine Reihe gestellt mit allem, was die Ärzte so „Ab 18“ produziert haben. Die folgenden Alben konnten daran leider nicht so recht anknüpfen, aber immerhin warfen sie die eine oder andere Perle ab, die sich jeder Fan des kruden Humors unbedingt zu Gemüte führen sollte. Am Besten auf „Godzilla auf Speed“ funktionieren dann wieder die Stücke, die nicht so gewollt wirken. Der Opener „Mädchen mit zwei Köpfen“ ist ähnlich, wie „Monster aus der grünen Lagune“ vom Vorgänger eine Hymne vor dem Herrn. „Punkrocksongapparat“ nimmt gekonnt die ganzen Klischee-Punks aufs Korn und „Jungs Junge“ versteht sich als kongeniale Antwort auf Farins „Jungs“, nur dass die Blutjungs das ganze einfach umdrehen und die Eltern den Rebellen und das Kind den Spießer gibt. Wenn bei euch immer noch regelmäßig die alten Ärzte-Scheiben laufen, schnappt euch diese Scheibe. Es lohnt sich. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?