 Heute schon eine neue Band zum Abfeiern gefunden? The Naked And Famous eignen sich ganz vorzüglich, um in der Indie-Disco für Begeisterungsstürme bei allen Fans von 80er Jahre beeinflussten Indie-Pop zu sorgen. Ihr Debüt-Album „Passive Me, Aggressive You“ macht in diesem Zusammenhang überhaupt keine Anstalten, sich in Zurückhaltung zu üben. Diese Crew hier steuert direkt auf die große Bühne zu. Ein Feuerwerk wird abgefackelt, die Effekt-Geräte hochgefahren und dann im Blitzlichtgewitter verharrt, als ob man den Kollegen von The Killers mal eben das Zepter in Sachen „Indierock fürs Stadion“ entreißen möchte. Die neuseeländische Crew um Sängerin Alisa Xayalith und ihren Gesangspartner Thom Powers klingt so zeitgeistig, dass ihr Song „Yound Blood“ sogar für einen aktuellen Viva-Werbesport verwendet wurde. Ob das am Ende Fluch oder Segen ist…? Warten wir es ab. Und genießen lieber die 12 weiteren Hits, die uns die Band hier aufs Tablett zaubern.
Heute schon eine neue Band zum Abfeiern gefunden? The Naked And Famous eignen sich ganz vorzüglich, um in der Indie-Disco für Begeisterungsstürme bei allen Fans von 80er Jahre beeinflussten Indie-Pop zu sorgen. Ihr Debüt-Album „Passive Me, Aggressive You“ macht in diesem Zusammenhang überhaupt keine Anstalten, sich in Zurückhaltung zu üben. Diese Crew hier steuert direkt auf die große Bühne zu. Ein Feuerwerk wird abgefackelt, die Effekt-Geräte hochgefahren und dann im Blitzlichtgewitter verharrt, als ob man den Kollegen von The Killers mal eben das Zepter in Sachen „Indierock fürs Stadion“ entreißen möchte. Die neuseeländische Crew um Sängerin Alisa Xayalith und ihren Gesangspartner Thom Powers klingt so zeitgeistig, dass ihr Song „Yound Blood“ sogar für einen aktuellen Viva-Werbesport verwendet wurde. Ob das am Ende Fluch oder Segen ist…? Warten wir es ab. Und genießen lieber die 12 weiteren Hits, die uns die Band hier aufs Tablett zaubern.
 Die Musiker der jungen Liedermacherin Maike Rosa Vogel klingt so locker flockig, dass man wirklich das Gefühl hat, man könnte über Wolkenformationen tänzeln. „Unvollkommen“ klingt gleich im Opener angemessen skizzenhaft, so dass die Lagerfeuer-Fraktion laut „juhe“ schreien dürfte. Die Texte sind erfrischend, weil sie sich eben nicht an den gängigen Klischees abarbeiten. Da stört es auch nicht weiter, dass es inhaltlich hin und wieder um Befindlichkeiten geht. Man fühlt sich stattdessen, als würde man dem Soundtrack eines charmanten Theaterstücks lauschen. Produziert wurde die Scheibe von niemand geringerem als Sven Regener, so dass die Musikerin auch im Rahmen der kürzlich absolvierten Tour von Element Of Crime viele neue Fans gefunden haben sollte. Lohnt sich ja auch, dieses unvollkommene Werk – bin immer noch vollkommen benommen.
Die Musiker der jungen Liedermacherin Maike Rosa Vogel klingt so locker flockig, dass man wirklich das Gefühl hat, man könnte über Wolkenformationen tänzeln. „Unvollkommen“ klingt gleich im Opener angemessen skizzenhaft, so dass die Lagerfeuer-Fraktion laut „juhe“ schreien dürfte. Die Texte sind erfrischend, weil sie sich eben nicht an den gängigen Klischees abarbeiten. Da stört es auch nicht weiter, dass es inhaltlich hin und wieder um Befindlichkeiten geht. Man fühlt sich stattdessen, als würde man dem Soundtrack eines charmanten Theaterstücks lauschen. Produziert wurde die Scheibe von niemand geringerem als Sven Regener, so dass die Musikerin auch im Rahmen der kürzlich absolvierten Tour von Element Of Crime viele neue Fans gefunden haben sollte. Lohnt sich ja auch, dieses unvollkommene Werk – bin immer noch vollkommen benommen.
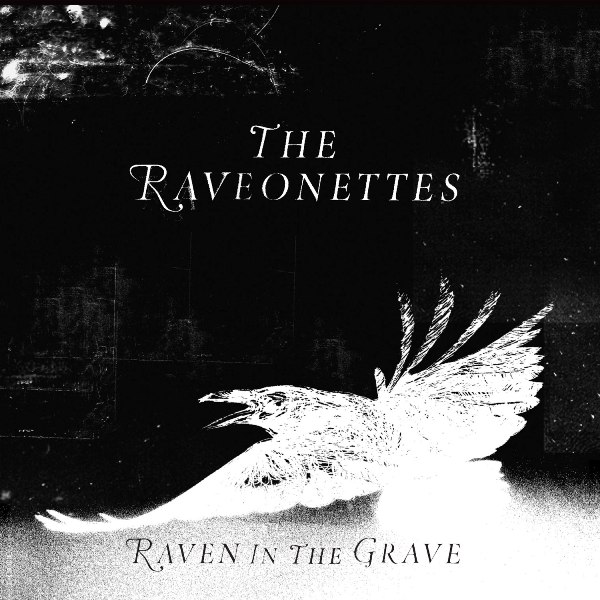 „Raven In The Grave“ könnt ihr dann hinterher mit den Renaissance-Poppern von The Raveonettes. Die Alben des Duos werden zwar immer kürzer, die Hits dafür immer schmissiger. Das aktuelle Album steckt mal wieder voller nebel-durchfluteter Perlen, die hübschen Melodien verstecken sich hinter lärmigen B-Movie-Sounds, aber genau deshalb ist jeder auf der Stelle verliebt in das Duo, der es nur ein einziges Mal im Live-Kontext erleben durfte. Das alles hat so viel Sex und Charme, dass man direkt seine White Stripes-Poster an der Wand zerknüllen möchte, um sie gegen einen „Plan 9 From Outer Space“-Eyecatcher auszutauschen. 9 Songs, 9 Perlen der düsteren Pop-Eleganz. „Summer Moon“, ich komme.
„Raven In The Grave“ könnt ihr dann hinterher mit den Renaissance-Poppern von The Raveonettes. Die Alben des Duos werden zwar immer kürzer, die Hits dafür immer schmissiger. Das aktuelle Album steckt mal wieder voller nebel-durchfluteter Perlen, die hübschen Melodien verstecken sich hinter lärmigen B-Movie-Sounds, aber genau deshalb ist jeder auf der Stelle verliebt in das Duo, der es nur ein einziges Mal im Live-Kontext erleben durfte. Das alles hat so viel Sex und Charme, dass man direkt seine White Stripes-Poster an der Wand zerknüllen möchte, um sie gegen einen „Plan 9 From Outer Space“-Eyecatcher auszutauschen. 9 Songs, 9 Perlen der düsteren Pop-Eleganz. „Summer Moon“, ich komme.
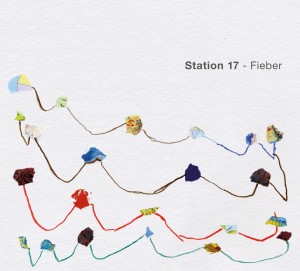 Station 17 gehören schon seit Jahren zu den Elektro-Pionieren des Landes. Mit Fettes Brot haben sie bereits gearbeitet, mit The Robocop Kraus sowieso und auch zahlreichen weiteren. Auf ihrem aktuellen Album „Fieber“ kommen sie in diesem Zusammenhang ganz ohne Gaststars aus. Die ganze Geschichte erinnert irgendwie an einen popmusikalischen Spielplatz, den der Zuhörer im Namen der Band durchschreiten darf. Die 11 Tracks wagen sich bisweilen sogar in krautrockige Gefilde, wobei die Band selbst die Frage aufwirft, was eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner dieses Genres sein soll. Die Experimentierfreude, mit der das Quintett hier zu Werke geht, ist bestenfalls ansteckend und überrascht einen mit zahlreichen Dissonanzen, Sprach- und Melodiefetzen, die dafür sorgen, dass einem auch gegen Ende hin nicht langweilig wird.
Station 17 gehören schon seit Jahren zu den Elektro-Pionieren des Landes. Mit Fettes Brot haben sie bereits gearbeitet, mit The Robocop Kraus sowieso und auch zahlreichen weiteren. Auf ihrem aktuellen Album „Fieber“ kommen sie in diesem Zusammenhang ganz ohne Gaststars aus. Die ganze Geschichte erinnert irgendwie an einen popmusikalischen Spielplatz, den der Zuhörer im Namen der Band durchschreiten darf. Die 11 Tracks wagen sich bisweilen sogar in krautrockige Gefilde, wobei die Band selbst die Frage aufwirft, was eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner dieses Genres sein soll. Die Experimentierfreude, mit der das Quintett hier zu Werke geht, ist bestenfalls ansteckend und überrascht einen mit zahlreichen Dissonanzen, Sprach- und Melodiefetzen, die dafür sorgen, dass einem auch gegen Ende hin nicht langweilig wird.
 Dikta wiederum klingen als wären Coldplay nach Island ausgewandert und hätten sich dort mit einem Orchester verabredet. „Get It Together“ ist ein größenwahnsinniges Album. Eines, das auf den ganzen großen Rausch der Emotionen abzielt. Sonderbarerweise gelingt dieses Unterfangen, ohne dass man sich für irgendetwas schämen müsste. Ganz im Gegenteil. Schon allein der Opener „Warnings“ führt den Kollegen von Snow Patrol auf grandiose Weise vor Augen, wie man ein melancholisches Schmachten in einen mehr als passablen Track überführt. Wenn die Band dann mit zunehmender Lauflänge etwas das Tempo drosselt und in „Final Call“ sogar einen Cellisten um Hilfe bittet, fühlt man sich nicht nur in Watte gepackt, man fühlt sich berauscht von den Klängen dieser isländischen Crew, die hier mal eben die gesamte erste Riege der Melancholie-Fraktion alt aussehen lässt.
Dikta wiederum klingen als wären Coldplay nach Island ausgewandert und hätten sich dort mit einem Orchester verabredet. „Get It Together“ ist ein größenwahnsinniges Album. Eines, das auf den ganzen großen Rausch der Emotionen abzielt. Sonderbarerweise gelingt dieses Unterfangen, ohne dass man sich für irgendetwas schämen müsste. Ganz im Gegenteil. Schon allein der Opener „Warnings“ führt den Kollegen von Snow Patrol auf grandiose Weise vor Augen, wie man ein melancholisches Schmachten in einen mehr als passablen Track überführt. Wenn die Band dann mit zunehmender Lauflänge etwas das Tempo drosselt und in „Final Call“ sogar einen Cellisten um Hilfe bittet, fühlt man sich nicht nur in Watte gepackt, man fühlt sich berauscht von den Klängen dieser isländischen Crew, die hier mal eben die gesamte erste Riege der Melancholie-Fraktion alt aussehen lässt.
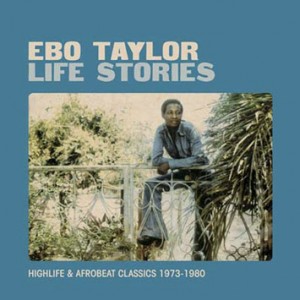 Die Wieder-Veröffentlichung von Ebo Taylors 70er Jahre Klassikern, sollte sich derweil niemand entgehen lassen, der auf Afrobeat und Jazz-Funk steht. „Life Stories – Highlife & Afrobeat Classics 1973 – 1980“ strotzt nur so vor entspannten Rhythmen und drahtigen Tanzflächenknallern. Auf den zwei Cds finden sich neben einigen Solo-Sachen auch einige Songs von Nebenprojekten, wie der Apagya Show Band und Assase Ase. Alle, die sich schon immer mal gefragt haben, wie der Buena Vista Social Club sich wohl im Disco-Remix anhören würde, sollten unbedingt mal reinhören. Es lohnt sich.
Die Wieder-Veröffentlichung von Ebo Taylors 70er Jahre Klassikern, sollte sich derweil niemand entgehen lassen, der auf Afrobeat und Jazz-Funk steht. „Life Stories – Highlife & Afrobeat Classics 1973 – 1980“ strotzt nur so vor entspannten Rhythmen und drahtigen Tanzflächenknallern. Auf den zwei Cds finden sich neben einigen Solo-Sachen auch einige Songs von Nebenprojekten, wie der Apagya Show Band und Assase Ase. Alle, die sich schon immer mal gefragt haben, wie der Buena Vista Social Club sich wohl im Disco-Remix anhören würde, sollten unbedingt mal reinhören. Es lohnt sich.
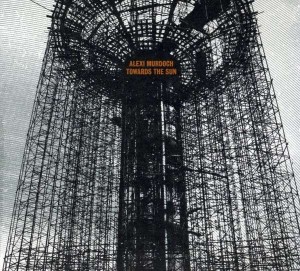 Alexi Murdoch lässt es derweil ziemlich ruhig angehen auf seinem aktuellen Silberling. Die sieben Songs seines Zweitwerks „Towards The Sun“ sind ein gefundenes Fressen für Freunde von Elliott Smith, Bob Dylan & The Stranglers. Nachdem der Halschotte/Halbgrieche schon den Soundtrack für das Roadmovie „Away We Go“ beisteuern durfte, hat er sich nun daran gemacht, die Welt um ein paar denkwürdige Schmachtfetzen zu erweitern, die durchaus auch für die Folk-Fraktion interessant sind. Wer auf romantischen Liedermacher-Pop mit Chören samt vereinzelter Widerhaken steht, sollte unbedingt mal reinhören.
Alexi Murdoch lässt es derweil ziemlich ruhig angehen auf seinem aktuellen Silberling. Die sieben Songs seines Zweitwerks „Towards The Sun“ sind ein gefundenes Fressen für Freunde von Elliott Smith, Bob Dylan & The Stranglers. Nachdem der Halschotte/Halbgrieche schon den Soundtrack für das Roadmovie „Away We Go“ beisteuern durfte, hat er sich nun daran gemacht, die Welt um ein paar denkwürdige Schmachtfetzen zu erweitern, die durchaus auch für die Folk-Fraktion interessant sind. Wer auf romantischen Liedermacher-Pop mit Chören samt vereinzelter Widerhaken steht, sollte unbedingt mal reinhören.
 John Vanderslice lässt sich derweil dazu hinreißen seine Songs auf seinem aktuellen Album mit Unterstützung eines Orchesters aufzunehmen. Das Magik*Magik Orchestra sorgt dabei dafür, dass viel Zuckerwatte fabriziert wird, das schadet dem Album aber keineswegs. Vielmehr verliert man sich in den schwelgerischen Songs des „White Wilderness“, lässt sich von dem Streichorchester umschmeicheln und staunt darüber, wie 19 Musiker miteinander harmonieren können, ohne dass es jemals überladen klingen würde. Wer auf melancholischen Pop der Marke Coldplay steht, aber den Stadion-Bombast am liebsten über Bord schmeißen würde, sollte unbedingt mal reinhören. Es lohnt sich. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
John Vanderslice lässt sich derweil dazu hinreißen seine Songs auf seinem aktuellen Album mit Unterstützung eines Orchesters aufzunehmen. Das Magik*Magik Orchestra sorgt dabei dafür, dass viel Zuckerwatte fabriziert wird, das schadet dem Album aber keineswegs. Vielmehr verliert man sich in den schwelgerischen Songs des „White Wilderness“, lässt sich von dem Streichorchester umschmeicheln und staunt darüber, wie 19 Musiker miteinander harmonieren können, ohne dass es jemals überladen klingen würde. Wer auf melancholischen Pop der Marke Coldplay steht, aber den Stadion-Bombast am liebsten über Bord schmeißen würde, sollte unbedingt mal reinhören. Es lohnt sich. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?