 Ceremony haben auf ihrer „Rohnert Park LP“ nicht nur eines der schicksten Slacker-Covers aller Zeiten am Start, sondern sorgen mit ihrer Melange aus Punk und Hardcore auch für gute Laune bei allen Fans von Black Flag bis Circle Jerks. Ihre Rotzfahne hängen sie in bester Japandroids-Manier in den Wind, so dass das Ganze trotz Knochenbrecher Attitüde immer wieder zeitgemäß beim Hörer ankommt. Wer sich zu chaotischen Sounds gerne den Hals verrenkt, sollte das Teil unbedingt mal anchecken. Da könnte man fast nostalgisch werden und das olle Rollbrett noch mal aus dem Speicher kramen. Dieser Sound hier ist wie geschaffen für die Half-Pipe. Ein Hardcore-Manifest in solch
Ceremony haben auf ihrer „Rohnert Park LP“ nicht nur eines der schicksten Slacker-Covers aller Zeiten am Start, sondern sorgen mit ihrer Melange aus Punk und Hardcore auch für gute Laune bei allen Fans von Black Flag bis Circle Jerks. Ihre Rotzfahne hängen sie in bester Japandroids-Manier in den Wind, so dass das Ganze trotz Knochenbrecher Attitüde immer wieder zeitgemäß beim Hörer ankommt. Wer sich zu chaotischen Sounds gerne den Hals verrenkt, sollte das Teil unbedingt mal anchecken. Da könnte man fast nostalgisch werden und das olle Rollbrett noch mal aus dem Speicher kramen. Dieser Sound hier ist wie geschaffen für die Half-Pipe. Ein Hardcore-Manifest in solch
energischer Form wird man diesen Sommer jedenfalls nicht mehr so schnell vor den Latz geknallt bekommen.
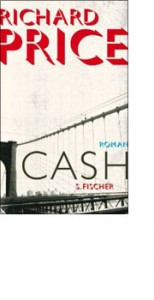 Der illustre Roman „Cash“ strotzt derweil nur so vor scharfsinnigen Dialogen, die nicht nur Obama seinen diesjährigen Sommerurlaub
Der illustre Roman „Cash“ strotzt derweil nur so vor scharfsinnigen Dialogen, die nicht nur Obama seinen diesjährigen Sommerurlaub
versüßten. Wie Richard Price hier ein kriminalistisches Verwirrspiel inszeniert, ist meisterhaft. Man braucht zwar ein bisschen, um sich im sprachlichen „Wirrvana“ zu Recht zu finden. Gerade zu Beginn erfordern die ellenlangen Dialog-Passagen viel Aufmerksamkeit vom Leser, mit zunehmender Länge allerdings imponiert einem eben diese Kompromisslosigkeit in Sachen Sprache,. Inhaltlich dreht sich das 520seitige Werk um einen Kronzeugen namens Eric, der einen Mord beobachtet und sich im Gespräch mit der Polizei immer tiefer in Widersprüche verstrickt. Bemerkenswert an dem Buch ist, dass Price dabei immer wieder an dem strahlenden Image von New York kratzt und so die Machtverhältnisse und Gewaltexzesse offen legt, die sich hinter der Linse abspielen. Geschickt verwebt er seinen gesellschaftskritischen Anspruch mit einer Kriminalgeschichte, die vor A-ha-Effekten nur so strotzt. Alles in allem: eine wirklich gelungene Kriminallektüre der anspruchsvolleren Sorte.
 Norman Palm, seines Zeichens Kunsthochschüler und
Norman Palm, seines Zeichens Kunsthochschüler und
noch dazu hin und her gerissen zwischen seinen beiden Heimatstädten Berlin und Paris, macht auf seinem neuen Album Liedermacher-Pop mit Gitarre im Schlepptau. Nix besonderes also, wenn man sich aber vor Augen führt, wie seine Stücke den Hörer charmant um die Finger wickeln, ohne dass der überhaupt etwas davon mitkriegt, kommt man schon ins Grübeln. Was ist das nur für eine schmissige
Melodie, die schon seit Stunden durch meine Gehirnwindungen stiefelt, ohne dass ihr Ursprung auszumachen wäre? Die Antwort lautet: das ist Norman Palm. Der versteht es sehr gekonnt einfache Melodien so mit Sounds zu verzieren, so dass sich ihre Halbwertszeit erhöht. Soll heißen: „Shore To Shore“ lässt Einfaches ziemlich kompliziert aussehen und macht Lust darauf, sich die ursprüngliche Melodie der Songs wieder frei zu schaufeln. Wer sich schon immer gefragt hat, wie es wohl klingen würde, wenn Erlend Oye eine Scheibe mit den Flaming Lips einspielen würde, der sollte sich dieses Album hier auf keinen Fall entgehen lassen.
 The Ghost gelten derweil als heißester
The Ghost gelten derweil als heißester
Scheiß aus britischen Elektro-Pop-Gefilden und sorgen mit „War Kids“ dafür, dass
die Besucher der hiesigen Diskotheken zu ihrer Musik im Kreis hüpfen werden.
Der Opener „Something New“ setzt die Latte ziemlich hoch an und sorgt für
euphorische Stimmung bei den Gästen. Vor allem die erste Hälfte dieses Debüts
macht Lust darauf, sich ein Laken überzustreifen und damit die Tanzfläche zu stürmen. „War Kids“ strahlt eine unbekümmerte Attitüde aus, wie man sie nur auf Debütalben vorfindet. Wo nehmen die geisterhaften Gestalten aus England nur all die Melodien her, die sie ihren Hörern hier vor den Latz knallen. Ich weiß es nicht. Abfeiern wird man die Songs, wie „City Lights“ und „Blood Of Romance“ trotzdem all Summer long. Regler hoch und mitwippen.
 Anvil waren derweil die Vorboten des Heavy Metal-Booms,
Anvil waren derweil die Vorboten des Heavy Metal-Booms,
welcher Mitte der 80er die Massen in seinen Bann zog. Nun hat sich Filmemacher Sascha Gervasi aufgemacht, die Geschichte der Jungs noch mal von hinten aufzurollen. Das Schöne daran. Hier erzählen zwar einerseits ein paar
alteingesessene Rockdinosaurier von ihren geplatzten Träumen, strahlen dabei aber einen solchen Enthusiasmus aus, dass sich das Teil in kürzester Zeit zum totalen Kult-Movie hochgespielt hat. Dieser Film könnte sogar zum
offiziellen Nachfolger von „This Is Spinal Tap“ werden, weil es einfach herzerwärmend ist, wenn die Jungs plötzlich auf Hochzeiten in die Seiten hämmern oder in Transsylvanien
auftreten und dort in einer 10.000er Halle vor 174 zahlenden Gästen spielen. „Anvil – Die Geschichte einer Freundschaft“ könnte der Band nun doch noch zu dem erhofften Ruhm verhelfen. Zu wünschen wäre es ihr.
 Kvelertak erinnern nicht nur cover-technisch an die Seelenverwandten von Baroness. Ihr Album entführt die Hellacopters in einen Hagelsturm und lässt die Herzen all jener höher schlagen, die sich schon immer gefragt haben, wie Turbonegro wohl im Metal-Modus klingen. Die Riff-Attacken
Kvelertak erinnern nicht nur cover-technisch an die Seelenverwandten von Baroness. Ihr Album entführt die Hellacopters in einen Hagelsturm und lässt die Herzen all jener höher schlagen, die sich schon immer gefragt haben, wie Turbonegro wohl im Metal-Modus klingen. Die Riff-Attacken
der norwegischen Jungs machen so viel Spaß, dass man schon beim zweiten Track jegliche Vergleiche in die Tonne kloppt. Kvelertak legen eine Energie an den Tag, die ansteckt. So macht metallischer Punk wieder Spaß. Kvelertak sind Kvelertak und auf die Plätze, fertig, los! Im Lotteriespiel um die Herzen der
Zuschauer haben sie auf die passenden Nummern gesetzt und dürften demnächst im örtlichen Metal-Club für schwitzende Häupter sorgen.
 Die Hardcore-Recken von Underdog versuchen derweil ein jüngeres Publikum von ihrem Sound zu überzeugen und veröffentlichen unter dem Namen „Matchless“ eine Ansammlung von 85/86er Demo-Aufnahmen und den Klassiker „Vanishing Point“ noch mal auf Silberling. Wer auf Bad Brains und Uppercut steht, sollte sich dieses Album unbedingt ins Regal stellen und zu den atemlosen Krachern die Fäuste gen Clubhimmel recken. Auch 21 Jahre nach Auflösung der Band hat die Musik der Gruppe nichts von ihrer Energie eingebüßt.
Die Hardcore-Recken von Underdog versuchen derweil ein jüngeres Publikum von ihrem Sound zu überzeugen und veröffentlichen unter dem Namen „Matchless“ eine Ansammlung von 85/86er Demo-Aufnahmen und den Klassiker „Vanishing Point“ noch mal auf Silberling. Wer auf Bad Brains und Uppercut steht, sollte sich dieses Album unbedingt ins Regal stellen und zu den atemlosen Krachern die Fäuste gen Clubhimmel recken. Auch 21 Jahre nach Auflösung der Band hat die Musik der Gruppe nichts von ihrer Energie eingebüßt.
 The Magic Numbers packen derweil die
The Magic Numbers packen derweil die
Melancholie-Keule aus und klingen im Opener „The Pulse“ ihres aktuellen Albums „The Runaway“ schlicht: ergreifend. Nachfolgend verlieren sie sich dann
immer wieder in verträumt anmutenden Chorgesängen, die einem einen sanften Schauer über den Rücken jagen. Wer sich schon immer gefragt hat, wie Oasis im Pop-Modus geklungen hätten, muss sich nur „Hurt So Good“ zu Gemüte führen. Dass einem bei so viel Schaumschlägerei nicht langweilig wird, dafür sorgen Songs, wie „A Start With No Ending“ und „Why Did You Call?“, die das gemächliche Tempo zumindest ein kleines bisschen nach oben schrauben. Also kommt schon. Lasst euch mal wieder treiben. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
UND WAS NUN?