Eingeläutet von einer zauberhaften Pianopassage schwingen sich Malajube auf ihrem Zweitling direkt empor zur Speerspitze der Popmusik. Oder ist das jetzt schon wieder Prog? Ist doch egal. Die Übergänge verschwimmen. Die erste Single „Ursuline“ – einfach nur eine Achterbahn der Gefühle. Ein nicht enden wollendes dynamisches Meisterstück, das einen nicht mehr los lässt. Genauso wie der Rest von „Labyrinthes“. Diesem Album, das sich konsequent jeglicher Struktur verweigert. So, als hätte die Band einfach zu viele Ideen gehabt und sich dann entschlossen alle aneinander zu pappen. Noch besser: ineinander zu verhaken. Und am Ende dann zehn Songs daraus gebastelt, die allesamt übersprudeln vor Ideen. Die klingen, als hätte man gerade eine Selters-Flasche geöffnet, die man vorher mal so richtig durchgeschüttelt hatte. Und dann lässt man die Brühe einfach raus. Sprengt alle Grenzen und genießt den Moment, wenn einen alle verdutzt anglotzen. So wie damals, als Radiohead dieses 7 Minuten-Monster namens „Paranoid Android“ auf die Menschheit losgelassen haben. Da dachten auch alle, die wären verrückt. Und am Ende haben sie dann alle auf Händen getragen. Malajube wird’s genauso gehen. Mit diesem Album. Dass so unfassbar ist, dass man es auf der Stelle ins Herz schließt.
Ebenso hinreisend ist das neue Album eines HipHop-Künstlers namens Amewu. Wo der plötzlich herkommt? Gute Frage. Aus Berlin natürlich. Die Musik klingt in etwa so, wie das „Intro“: „Ich freu mich jetzt schon auf den zweiten Song“. Und wie! Die Reime überschlagen sich. Die Wortspiele treffen ins Schwarze. Die Raps klingen nicht gehetzt. Nicht wie so eine kläffende Töle auf Speed. Stattdessen elegant. Geschickt verpackt. Versiert dargereicht. So, als würde der Protagonist das Ganze schon ewig machen. Was machen? Na, Doubletime-Reimen. Zehn Jahre genau genommen. Es scheint Berufung zu sein – nicht Beruf. Und er ist ehrlich genug zuzugeben, dass „reifen lassen“ eben manchmal auch „schleifen lassen“ bedeutet. Manche reden eben zu viel und rappen zu wenig. Das ist doch mal ne Ansage. Und dieses Album ist voll davon. „Entwicklungshilfe“ hat er es getauft. Und rammt damit mal eben die halbe deutsche HipHop-Szene zurück in die Kiste. Einschläfernde Sounds gibt’s ja schon genug. Deswegen wird hier ein elektronisch anmutender Soundteppich aufgefahren, prominent besetzt mit wortgewaltigen Punchlines. Am Ende entsteht daraus der bisher eindrucksvollste Rapentwurf des Jahres. Mal sehen ob Marteria da gleichzuziehen kann.
Und jetzt mal rüber gespitzt in rockigere Gefilde. Ein schickes Klavier schleppen sie da über den Asphalt. Die Jungs von Montag. Dem ungeliebten Anhängsel des Wochenendes. Trotzdem klimpern die drei auf ihrem dritten Album geradezu euphorisch drauf los und meistern den Balanceakt zwischen großer Geste und echter Emotion über weite Strecken äußerst gekonnt. Zugegeben: ein Cover eines Udo Jürgens Songs („Tausend Jahre sind ein Tag“). Da ist auch bei mir Schicht im Schacht. Aber kann man ja skippen. Und dann bietet das Album ja noch ein paar weitere Schmankerl deutschsprachiger Piano-Gitarren-Pop-Glückseligkeit für alle, denen Anajo eine Spur zu schmalzig und Tomte zu gedehnt klingen. Eine neue Räumlichkeit will sich mir dann zwar nicht erschließen. Davon haben U2 ja schon genug. Aber trotzdem charmant zu hören, dass die Hintergrundmelodien im heimischen Wohnzimmer eingesummt wurden. Alles in allem ein äußerst ambitioniertes Werk, das vielleicht gegen Ende etwas mehr Straffung gebraucht hätte. Dennoch: gut gemacht, Jungs.
Und wer dann hinterher gleich weiterhören will, der dürfte vom neuesten Output der charmanten „Müssen alle mit“-Reihe ordentlich Futter in die Gehörgänge geblasen bekommen. Auf „. Müssen alle mit. 5“ geben sich diesmal die wunderbaren Superpunk („Ja, ich bereue alles“), die außerordentlichen Ja, Panik („Marathon“) und die euphorisch getrimmten 1000 Robota („Mein Traum“) die Klinke in die Hand. Ausfälle gibt’s keine. Es wurde schlicht und ergreifend alles angekarrt, was hierzulande Rang und Namen hat. Einziger Kritikpunkt ist vielleicht, dass einem das Meiste davon eh schon bekannt sein könnte. Womit noch auf die Bonus-Cd verwiesen wäre. Auf der gibt’s nämlich allerhand Akustisches, Flippiges und Krachendes von Bratze bis Niels Frevert. Das macht Spaß und rundet die ganze Deutschrock-Schose von Kettcar bis Tocotronic gekonnt ab. Ich jedenfalls kann mir gerade keinen schöneren Sampler für den anstehenden Frühling vorstellen, auch weil dieser herrliche Retro-Look so grundsympathisch rüber kommt, dass man sich nur zu gerne mit Gänseblümchenkranz bewaffnet ins Gras wirft.
Hinterher zehren dann The Great Bertholinis mal wieder an den Wodka-Vorräten im Schrank. Dabei klingt ihr aktuelles Werk „Planting A Tree Next To A Book“ gar nicht mehr so stark nach Trinkerhymne, sondern über weite Strecken nach verträumter Melancholiker-Runde. Nachts um eins die letzte Pulle an der Theke. Dann genau will man einen Song, wie „Time Machine“ um die Ohren gehauen bekommen. Alternativ kann man sich das Ganze aber auch im Würzburger Jugendkulturhaus Cairo reinziehen. Da steht die Band nämlich am 28.3. live auf der Bühne. Und wird mal wieder ein weltmusikalisches Set der Extraklasse auffahren. Zusammen genommen mit dem treibenden Vorgänger sollte sich dabei ein äußerst charmanter Mix aus chaotischen Szenen und schunkelnder Wohnzimmeratmosphäre ergeben. Auf jeden Fall solltet ihr euch das Ganze nicht entgehen lassen. Denn die Band soll live eine echte Macht sein.
Mit gehisster Piratenflagge geht’s hinterher weiter zu Alela Diane. Die wurde für ihr 2007er Werk vom renommierten „Rough Trade“-Label mal eben mit dem imaginären Award für das Album des Jahres ausgezeichnet und gibt sich auf dem Nachfolger „To Be Still“ äußerst entspannt. Dabei ist ihr Album ein äußerst gelungenes Beispiel dafür, dass Folk endgültig im Pop angekommen ist. Leider wird die Musik dadurch ihrer Ecken und Kanten beraubt und so schimmert „To Be Still“ vom ersten Moment an so dermaßen grell, dass man sich immer wieder wünscht die Musikerin würde wirklich ihrer Seelenverwandtschaft zu Joanna Newsom freien Lauf lassen. Die erzeugt zwar durch ihr sprachliches Dauerfeuer auch hin und wieder Stirnrunzeln, lotet aber die Grenzen des Folk wesentlich gekonnter aus, als die liebe Miss Diane. Alles in allem ist „To Be Still“ dennoch eine Platte, die man lieb gewinnen kann. Gerade weil die Songs nach mehreren Durchläufen nichts von ihrem Charme einbüßen. Dennoch lässt das Album ein gewisses Kalkül in Bezug auf den Massenmarkt erahnen, was dem Ganzen einen faden Beigeschmack verleiht. Am Besten also ihr hört selbst mal rein. Musik, die solch widersprüchliche Emotionen auf den Plan ruft, verdient es sich mit ihr auseinanderzusetzen.
Anschließend biegen wir dann mal ab in Richtung Hipster-Viertel. Da trommeln Buraka Som Sistema auf alles ein, was an perkussivem Material in der Gegend rum steht. Zudem gibt’s reichlich angesagte Gastauftritte von Kano bis M.I.A., was sich natürlich als äußerst verkaufsträchtig herausstellen dürfte. Aber auch abseits der großen Namen hat „Black Diamond“ aufgrund seiner ruhelosen Tracks allerhand Argumente im Gepäck, sich als Hörer in dem weltmusikalischen Allerlei zu verheddern. Jedenfalls dürfte es derzeit kaum eine Scheibe geben, die den Zeitgeist im ähnlichen Maße auf den Punkt bringt. Während M.I.A. mit ihren „Paper Planes“ gerade die Häfen der großen Nationen ansteuert, um vollends abzuheben, versetzt einen das pulsierende Trommeln dieses Silberlings geradewegs in die Straßenschluchten Portugals. Anschließend überführt es das atemlose Treiben in die angesagten Hotspots Londons und erschafft einen kulturellen Soundclash, dessen Charme man sich nur schwer entziehen kann.
Zum Runterkommen hinterher eignet sich der atmosphärische Sound von Robyn Hitchcock & The Venus 3. Mit einer illustren Riege an Gaststars aus dem Hause The Decemberists und Konsorten zaubern uns der liebe Peter Buck (R.E.M.) und seine Jungs einen psychedelischen Schneewalzer aufs Parkett, dass man sich einfach zurücklehnen und die Augen schließen möchte. Obwohl die Scheibe sich inhaltlich als nicht allzu leicht verdaulich herausstellt, klingt sie dennoch seltsam beschwingt. So als würden sich Hitchcock und Buck ein grandios in Szene gesetztes Duell um den Vorsitz in der Band liefern. Diese Dynamik führt letztlich dazu, dass man sich der Musik von „Goodnight Oslo“ praktisch vorbehaltlos ausliefert. Und bei einem stampfenden Monster, wie „Saturday Groovers“ geradezu beschwingt mit den Fingern schnippt. So kann es weitergehen.
Vielleicht mit einer Prise deutschsprachiger Rockmusik? Jupiter Jones melden sich nämlich just in diesen Tagen mit einem kleinen aber feinen Vorgeschmack auf ihr nächstes Album zurück. Auf der durchweg gelungenen EP „Das Jahr in dem ich schlief“ fahren sie mal wieder ihre Tentakeln in Richtung Muff Potterscher Phantasiewelten aus und zaubern einem vor allem mit dem gleichnamigen Opener ein breites Grinsen ins Gesicht. Der Sound ist dabei zwar spürbar glatter geraten, als noch zu den wilden Anfangstagen, macht aber nix, wenn die Melodien einen so wohlbehütet einlullen, als würde man gerade unter reichlich Bauchpinselei in den Lieblingsclub einlaufen. Ergänzt wird das Ganze um drei schicke Non-Album-Tracks von denen vor allem das sympathische „Die Nacht in der Slayer in Uedelhoven spielten“ im Gedächtnis kleben bleibt. Also am besten voll aufdrehen und abgehen. Alles Weitere folgt in Kürze, wenn der komplette Longplayer am Start ist. Die Vorfreude jedenfalls ist aufgrund dieses kleinen Appetizers schon mal ins Unermessliche gestiegen.
Anschließend sprießt dann mal wieder ein hübsches Folk-Pop-Pflänzchen aus dem Boden, das zwar keinem weh tut, aber dennoch zu einem gefälligen Schunkel-Stündchen am Lagerfeuer einlädt. Andrew Bird jedenfalls hat den Dreh raus, wie man den Hörer mit reduzierten Mitteln bei der Stange hält. Immer wieder schlagen seine Songs unerwartete Haken und verdrehen dem geneigten Melancholiker so lange den Kopf, bis dem ganz schwindelig wird vor Glück. Der Künstler wagt sich zwar in Sachen experimentelle Songstrukturen nicht ganz so weit raus, wie zuletzt die Fleet Foxes. Macht aber nix, weil die Songs alle sehr mitreißend geraten sind. „Noble Beast“ ist am Ende einfach der perfekte Soundtrack, um sich mit der Liebsten gegenseitig die Haare zu durchwuscheln und anschließend einen Kranz aus Gänseblümchen drüber zu stülpen. Knutsche-Musik eben. Schlicht herzallerliebst. Ein Frühlingsalbum. Wie geschaffen zur Dauerbeschallung. Also zieht es euch rein. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
 Eingeläutet von einer zauberhaften Pianopassage schwingen sich
Eingeläutet von einer zauberhaften Pianopassage schwingen sich  Ebenso hinreisend ist das neue Album eines HipHop-Künstlers namens
Ebenso hinreisend ist das neue Album eines HipHop-Künstlers namens  Und jetzt mal rüber gespitzt in rockigere Gefilde. Ein schickes Klavier schleppen sie da über den Asphalt. Die Jungs von
Und jetzt mal rüber gespitzt in rockigere Gefilde. Ein schickes Klavier schleppen sie da über den Asphalt. Die Jungs von  Und wer dann hinterher gleich weiterhören will, der dürfte vom neuesten Output der charmanten „Müssen alle mit“-Reihe ordentlich Futter in die Gehörgänge geblasen bekommen. Auf „.
Und wer dann hinterher gleich weiterhören will, der dürfte vom neuesten Output der charmanten „Müssen alle mit“-Reihe ordentlich Futter in die Gehörgänge geblasen bekommen. Auf „. 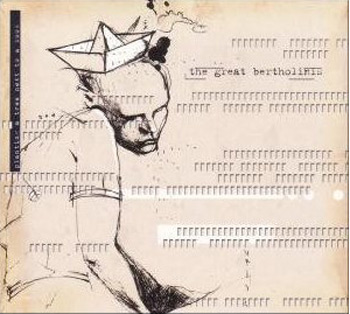 Hinterher zehren dann
Hinterher zehren dann  Mit gehisster Piratenflagge geht’s hinterher weiter zu
Mit gehisster Piratenflagge geht’s hinterher weiter zu  Anschließend biegen wir dann mal ab in Richtung Hipster-Viertel. Da trommeln
Anschließend biegen wir dann mal ab in Richtung Hipster-Viertel. Da trommeln 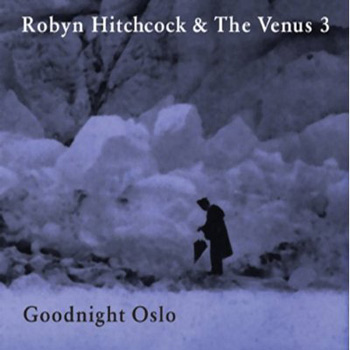 Zum Runterkommen hinterher eignet sich der atmosphärische Sound von
Zum Runterkommen hinterher eignet sich der atmosphärische Sound von  Vielleicht mit einer Prise deutschsprachiger Rockmusik?
Vielleicht mit einer Prise deutschsprachiger Rockmusik? 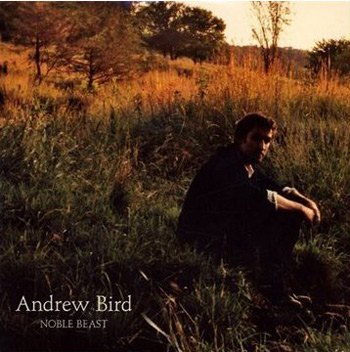 Anschließend sprießt dann mal wieder ein hübsches Folk-Pop-Pflänzchen aus dem Boden, das zwar keinem weh tut, aber dennoch zu einem gefälligen Schunkel-Stündchen am Lagerfeuer einlädt.
Anschließend sprießt dann mal wieder ein hübsches Folk-Pop-Pflänzchen aus dem Boden, das zwar keinem weh tut, aber dennoch zu einem gefälligen Schunkel-Stündchen am Lagerfeuer einlädt.
UND WAS NUN?