Hach, wenn einem das Frontcover schon so herzlich zuzwinkert, wie beim neuen Album von Stun, dann möchte man sich einfach nur ein ruhiges Plätzchen auf der Wiese suchen, sich Kopfhörer überstülpen und in Richtung Wolkenfetzen grinsen. So als wollte man sagen. Bätsch. Euer ewiges Geheule kann mir gar nix. Und wenn jene Band dann in ihrer Jugend auch noch die alten Scheiben von Jimmy Eat World und Favez wie einen kleinen Schatz in den Armen wog. Dann möchte man das Zentrum der Rockmusik -der herzensguten wohlgemerkt- kurzerhand nach Bremen transferieren. Da kommen die vier Jungs nämlich her. Und sie scheinen zu wissen, dass das, was früher mal unter dem durchaus liebenswerten Begriff Emo aus den Boxen dröhnte. Dass das eben auch deshalb so faszinierend und mitreißend klang, weil es sich Fehler erlaubte. Weil es die Ecken und Kanten nicht glatt bügelte. Weil es den Mut hatte mal abzuschweifen. Zu lärmen, wenn es das eigene Seelenheil erforderte. Und genau deshalb möchte man dieses Album jedem vor die Füße knallen, der sich zum angesagten Konsens-Pop von Hawthorne Heights und Konsorten ins Blitzlichtgewitter wirft. „And At Least You Dance“ ist ganz sicher keine schwierige Platte, wie Sonic Youth sie hin und wieder an den Mann bringen. Nein. Stun vermengen vielmehr das vertrackte von manchem Drive Like Jehu oder Texas Is The Reason Song mit dem Romantik-Pop von Jimmy Eat World. Mitreißend wird das ganze vorwiegend aufgrund der beiden Gitarren, die sich immer wieder beeindruckende Duelle liefern. Am Ende verzeiht man ihnen bei so viel Glückseligkeit dann sogar die Annäherung an U2s „With Or Without You“. War ja eh nicht so gemeint. Und mal im ernst. War ja eigentlich mal ein ganz netter Song, bevor er vom Formatradio zerquetscht wurde.
Womit wir uns mal in etwas düstere Zauberwelten wagen. Ich meine, was soll man eigentlich noch sagen zu solch märchenhaften Fanfaren, die uns auf Asobi Seksus aktuellen Album „Hush“ das Zwerchfell massieren. In jedem Fall kann man sich dem Rausch der Musik nur schwer verwehren, wenn einen diese zerbrechliche Wall Of Sound zärtlich in die Arme nimmt und den Nacken grault. Alles fließt vor sich hin, als wollte die Band dem Post Rock das Röckchen ausziehen. Jedenfalls schimmert trotz der vernebelten und epischen Stücke immer wieder dieses sagenhafte Organ von Yuki Chikudate aus dem Dunkel der Nacht, als wollten sie David Lynch einen Kussmund zuwerfen und andeuten, er möge sie doch bitte mal für einen seiner Filme engagieren. Der Name der Band bedeutet übrigens übersetzt so viel wie „playful sex“ und verortet die Crew ganz stilbewusst im hippen Shoegazing-Umfeld. Auftritte in trendigen TV-Reihen, wie „The L Word“ und „Skins“ dürften dafür sorgen, dass sich zahlreiche verträumte Herzen auf dem Wölkchen niederlassen, das dieses Quartett watteweich am Himmelszelt ausbreitet. Insgesamt vielleicht die süßeste Dream Pop-Versuchung des ausklingenden Winters, welche dafür sorgt, dass immer wieder Sonnenstrahlen aus dem Wolkendickicht über die weiße Schneelandschaft herfallen und mit ihrem neckischen Blick ein Blümchen inmitten der Schneedecke frei schaufeln.
Schade nur, dass Peter Katz & The Curious hinterher ein bisschen zu offensichtlich in Richtung Glückseligkeit abheben. Anfangs fühlt man sich ja noch watteweich eingelullt von so viel beseelter Hingabe. Und dennoch ist „More Nights“ leider immer auf einem sehr schmalen Grad zwischen echter Intimität und großer Geste unterwegs. Jedenfalls fühlt man sich das ein oder andere Mal stark an die Untaten erinnert, die oftmals im Radio des gepflegten Vorgartens der Nachbarn vor sich hinlaufen, während sie ihre Blumenbeete hegen und pflegen. Am Ende entsteht daraus ein Album, das keinem sonderlich weh tut, aber dadurch eben auch die Möglichkeit verschenkt, wirklich dorthin zu gehen, wo es einen berühren könnte. Stattdessen schleicht die Band mit verstohlenem Blick in Richtung Konzertbühne und liefert ein Set ab. So fehlerlos. So versiert. Dass immer wieder der Verdacht aufkommt, die Musik wäre einfach zu schön, um wahr zu sein.
Ruby Throat meistern diesen Umstand dann wiederum dadurch, dass sie einen in einen dunklen Wald geleiten, das Licht am Himmelszelt ausknipsen und dich mit verstörend gruseligen Songs vor sich hertreiben. Die düstere Atmosphäre von „The Ventriloquist“ erinnert dabei immer wieder an die besten Momente, die Emiliana Torrini in ihrer Frühphase fabrizierte. Kurz gesagt: Sängerin Katie Jane Garside klingt eigentlich stark nach Björks Zwillingsschwester, die sich das Gesicht mit Kajal beschmiert, damit aber nicht in der Emoecke landet, sondern eher in den traumwandlerischen Weiten, die Bat For Lashes vor kurzem schon in der Gunst der Indiehörer ganz weit nach oben schießen ließ. Die zwölf weitgehend akustischen Stücke dieses kargen, verfolkten, und dennoch niemals erschöpfenden Klangkosmoses genießt man am besten bei Kerzenlicht unter der Bettdecke. Man sollte nur aufpassen, dass man dabei nicht das ganze Zimmer in Brand setzt.
Währenddessen fragt man sich, was Aiden Moffat, den Frontmann von Aiden Moffat & The Best-Ofs eigentlich so antreibt, nur knapp ein Jahr nach seinem letzten Release schon wieder ein neues Album an den Start zu bringen. Vielleicht lag es ja am Engagement der beteiligten Musiker, die sich als offene Gesellschaft unter dem Namen „The Best-Ofs“ an der Platte beteiligten. Jedenfalls waren da durchaus illustre Namen darunter: Stevie Jones zum Beispiel, den manche vielleicht von der Backing Band von Isobell Campbell & Mark Lanegan kennen. Oder der Ex-Delgados Member Alun Woodward. Jedenfalls liegt die Platte bereits seit gut einem Jahr fertig im Ofen und wartet nur darauf jetzt noch mal so richtig schön befeuert zu werden. Musikalisch hat sich der sexuelle Aspekt auf „How To Get To Heaven From Scotland“ in die Ecke verzogen und Platz geschaffen für zärtliche, oftmals karg instrumentierte Liebeslieder, die sich mehr oder weniger schemenhaft ihren Weg durch die Gehörgänge bahnen. Dass dabei auch der ein oder andere verzichtbare Track entstanden ist, scheint dem ehemaligen Arab Straper ebenso wenig zu jucken, wie die Tatsache, dass vielleicht so mancher demnächst den Überblick verlieren könnte, wenn er im Zuge dieser Veröffentlichung schon wieder zwei neue Scheiben ankündigt. Aber sei es drum. Für Freunde der lo-fi-poppigen Liebesgeschichten sollte sich hier sicher das ein oder andere Schmankerl aus der trügerisch Idylle des kongenialen Frontcovers schälen
wem das alles zu anstrengend ist, der kann ja immer noch auf einen Sprung bei Dear Reader vorbei schauen. Ihren Stücken möchte man sich jedenfalls sofort um den Hals werfen, wie Perlenketten. Auf leisen Pfoten tapsen sie an einen heran, nur um sich dann –bei zeitweise spürbarer stimmlicher Nähe zu Kate Nash, die ja wiederum wie Regina Spektor klingt- in detailreiche Arrangements zu verstricken. Sogar Streichinstrumente schälen sich da immer wieder aus dem breit arrangierten Korsett der Musik. Dass die Scheibe dennoch so luftig klingt, wie Nachthemden, verdanken Dear Reader der sprunghaften Stimme von Cherilyn McNeil aus Südafrika, die scheinbar spielend das stimmungsvolle Gesamtbild ergänzt. In gewisser Weise haben wir hier am Ende einen der ersten musikalischen Höhepunkte des noch so kurzen Jahres vorliegen, weil „Replace Why With Funny“ auch gegen Ende nicht abfällt, wirft es zahllose Indie-Popperlen für den anstehenden Frühling ab. Also Gänseblümchen ins Haar stecken und den Winter einfach mal Winter sein lassen. Stellt sich nur die Frage, wie dieser melancholisch liebenswürdige Popentwurf jetzt noch zu toppen ist? Vielleicht wäre ja erstmal ein passender Konter angebracht.
Etwas Elektronisches zur Auflockerung? Bitteschön… Bpitch haben nämlich einen neuen Elektronika/Avandgarde-Hop Act am Start, der sich ganz zärtlich an einen heran schmiegt. AGF/Delay alias Antye Greie und Sasu Ripatti haben sich auf „Symptoms“ zusammen gerauft ihrer Vorstellung von futuristischer Popromantik ein Sprachrohr zu verleihen. Dass Erstere erst kürzlich das vierte Album von Ellen Allien produzierte, hat sicher so manchen Track dieser elektronischen Spielwiese beeinflusst. Dennoch wird der Puls des Elektronischen immer wieder von einem sanften Hauch dubbiger Klangwelten umschmeichelt. Klingt jetzt alles ziemlich verkopft, was ich hier schreibe – wirkt aber auf Platte homogen und ausgewogen. Die Scheibe läuft niemals Gefahr, sich am Konsens anzubiedern. Was ja durchaus hätte passieren können, wenn man sich vor Augen führt, dass Sasu Ripatti nebenher auch gerne mal für die Scissor Sisters ein Textblatt entwirft. In diesem Fall hält er die große Geste aber gerne im Jackentäschchen versteckt und drückt diesem bemerkenswerten Elektro-Album einen nahezu subtilen Stempel auf.
Die große Geste wagen hinterher dann die Jungs von Razorlight. Die sind ja bereits auf dem selbst betiteltem Zweitling dem Größenwahn verfallen. Auf „Slipway Fires“ wirkt nun alles noch eine Spur pompöser als auf dem Vorgänger. Das Schöne daran ist, dass die Melodien immer noch so sternenklar glitzern, dass man sich nur zu gerne am Himmelszelt der poppigen Glückseligkeit ergötzt. Wie Sternschnuppen treffen einen Hits, wie das hochtrabende „Hostage Of Love“ oder die erste Single „Wire To Wire“ mitten ins Herz. Manche werden da jetzt wieder schimpfen, dass das doch alles eine Spur zu dick aufgetragen ist. Aber mal im ernst: hin und wieder möchte man doch einfach mal die Seele baumeln lassen und sich vom Sog der Melodien mitreißen lassen. Razorlight haben mit diesem Album endgültig dem Indieclub abgeschworen. Sie stürmen unter großem Konfettiregen ins Stadion. Und haben es geschafft die schmalzigen Ansätze des Vorgängers mit einer Portion Leichtfüßigkeit zu kontern. Alles in allem kann man dieser Platte also nicht mal vorwerfen, dass sie an ihrer Perfektion kranken würde. Sie ist für den Moment genommen einfach nur ein leuchtender Punkt am Popstarfirmament, dessen Halbwertszeit sich aufgrund ihrer eingängigen Melodien als äußerst kurzlebig herausstellen dürfte. Mir persönlich geht das allerdings ziemlich am Arsch vorbei. Denn diese Songs feiern den Augenblick. Und wirken gerade deshalb wie ein bezaubernde Ode an die pompöse Popwelt der Gegenwart. Und damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
//alexander nickel-hofengart
 Hach, wenn einem das Frontcover schon so herzlich zuzwinkert, wie beim neuen Album von
Hach, wenn einem das Frontcover schon so herzlich zuzwinkert, wie beim neuen Album von  Womit wir uns mal in etwas düstere Zauberwelten wagen. Ich meine, was soll man eigentlich noch sagen zu solch märchenhaften Fanfaren, die uns auf
Womit wir uns mal in etwas düstere Zauberwelten wagen. Ich meine, was soll man eigentlich noch sagen zu solch märchenhaften Fanfaren, die uns auf 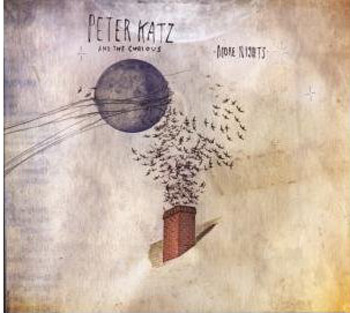 Schade nur, dass
Schade nur, dass  Ruby Throat
Ruby Throat Währenddessen fragt man sich, was Aiden Moffat, den Frontmann von Aiden Moffat & The Best-Ofs eigentlich so antreibt, nur knapp ein Jahr nach seinem letzten Release schon wieder ein neues Album an den Start zu bringen. Vielleicht lag es ja am Engagement der beteiligten Musiker, die sich als offene Gesellschaft unter dem Namen „The Best-Ofs“ an der Platte beteiligten. Jedenfalls waren da durchaus illustre Namen darunter: Stevie Jones zum Beispiel, den manche vielleicht von der Backing Band von Isobell Campbell & Mark Lanegan kennen. Oder der Ex-Delgados Member Alun Woodward. Jedenfalls liegt die Platte bereits seit gut einem Jahr fertig im Ofen und wartet nur darauf jetzt noch mal so richtig schön befeuert zu werden. Musikalisch hat sich der sexuelle Aspekt auf „How To Get To Heaven From Scotland“ in die Ecke verzogen und Platz geschaffen für zärtliche, oftmals karg instrumentierte Liebeslieder, die sich mehr oder weniger schemenhaft ihren Weg durch die Gehörgänge bahnen. Dass dabei auch der ein oder andere verzichtbare Track entstanden ist, scheint dem ehemaligen Arab Straper ebenso wenig zu jucken, wie die Tatsache, dass vielleicht so mancher demnächst den Überblick verlieren könnte, wenn er im Zuge dieser Veröffentlichung schon wieder zwei neue Scheiben ankündigt. Aber sei es drum. Für Freunde der lo-fi-poppigen Liebesgeschichten sollte sich hier sicher das ein oder andere Schmankerl aus der trügerisch Idylle des kongenialen Frontcovers schälen
Währenddessen fragt man sich, was Aiden Moffat, den Frontmann von Aiden Moffat & The Best-Ofs eigentlich so antreibt, nur knapp ein Jahr nach seinem letzten Release schon wieder ein neues Album an den Start zu bringen. Vielleicht lag es ja am Engagement der beteiligten Musiker, die sich als offene Gesellschaft unter dem Namen „The Best-Ofs“ an der Platte beteiligten. Jedenfalls waren da durchaus illustre Namen darunter: Stevie Jones zum Beispiel, den manche vielleicht von der Backing Band von Isobell Campbell & Mark Lanegan kennen. Oder der Ex-Delgados Member Alun Woodward. Jedenfalls liegt die Platte bereits seit gut einem Jahr fertig im Ofen und wartet nur darauf jetzt noch mal so richtig schön befeuert zu werden. Musikalisch hat sich der sexuelle Aspekt auf „How To Get To Heaven From Scotland“ in die Ecke verzogen und Platz geschaffen für zärtliche, oftmals karg instrumentierte Liebeslieder, die sich mehr oder weniger schemenhaft ihren Weg durch die Gehörgänge bahnen. Dass dabei auch der ein oder andere verzichtbare Track entstanden ist, scheint dem ehemaligen Arab Straper ebenso wenig zu jucken, wie die Tatsache, dass vielleicht so mancher demnächst den Überblick verlieren könnte, wenn er im Zuge dieser Veröffentlichung schon wieder zwei neue Scheiben ankündigt. Aber sei es drum. Für Freunde der lo-fi-poppigen Liebesgeschichten sollte sich hier sicher das ein oder andere Schmankerl aus der trügerisch Idylle des kongenialen Frontcovers schälen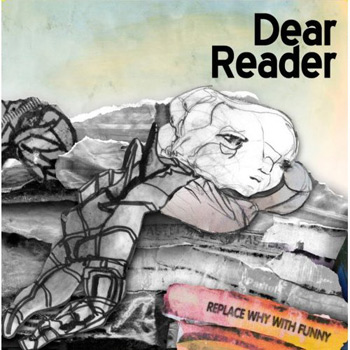 wem das alles zu anstrengend ist, der kann ja immer noch auf einen Sprung bei
wem das alles zu anstrengend ist, der kann ja immer noch auf einen Sprung bei  Etwas Elektronisches zur Auflockerung? Bitteschön… Bpitch haben nämlich einen neuen Elektronika/Avandgarde-Hop Act am Start, der sich ganz zärtlich an einen heran schmiegt.
Etwas Elektronisches zur Auflockerung? Bitteschön… Bpitch haben nämlich einen neuen Elektronika/Avandgarde-Hop Act am Start, der sich ganz zärtlich an einen heran schmiegt.  Die große Geste wagen hinterher dann die Jungs von Razorlight. Die sind ja bereits auf dem selbst betiteltem Zweitling dem Größenwahn verfallen. Auf „Slipway Fires“ wirkt nun alles noch eine Spur pompöser als auf dem Vorgänger. Das Schöne daran ist, dass die Melodien immer noch so sternenklar glitzern, dass man sich nur zu gerne am Himmelszelt der poppigen Glückseligkeit ergötzt. Wie Sternschnuppen treffen einen Hits, wie das hochtrabende „Hostage Of Love“ oder die erste Single „Wire To Wire“ mitten ins Herz. Manche werden da jetzt wieder schimpfen, dass das doch alles eine Spur zu dick aufgetragen ist. Aber mal im ernst: hin und wieder möchte man doch einfach mal die Seele baumeln lassen und sich vom Sog der Melodien mitreißen lassen.
Die große Geste wagen hinterher dann die Jungs von Razorlight. Die sind ja bereits auf dem selbst betiteltem Zweitling dem Größenwahn verfallen. Auf „Slipway Fires“ wirkt nun alles noch eine Spur pompöser als auf dem Vorgänger. Das Schöne daran ist, dass die Melodien immer noch so sternenklar glitzern, dass man sich nur zu gerne am Himmelszelt der poppigen Glückseligkeit ergötzt. Wie Sternschnuppen treffen einen Hits, wie das hochtrabende „Hostage Of Love“ oder die erste Single „Wire To Wire“ mitten ins Herz. Manche werden da jetzt wieder schimpfen, dass das doch alles eine Spur zu dick aufgetragen ist. Aber mal im ernst: hin und wieder möchte man doch einfach mal die Seele baumeln lassen und sich vom Sog der Melodien mitreißen lassen.
UND WAS NUN?