„Enter The Vaselines“ – was soll man da denn noch hinzufügen? Eine der einflussreichsten Bands der 90er, die unter anderem von Kurt Cobain verehrt wurde, hat endlich ihr musikalisches Denkmal gesetzt bekommen. Soll heißen: auf dieser Doppel-Cd mit zauberhaftem Booklet und jeder Menge Bonus-Material bekommt man das volle Programm in Sachen schief gesungener Antihaltung vor den Latz geknallt. Die meisten werden dabei wohl vor allem das von Nirvana nachgespielte „Jesus Wants Me For A Sunbeam“ oder „Molly´s Lips“ von der „Incesticide“-LP in guter Erinnerung behalten haben. Ansonsten gibt’s neben den beiden EPs „Son Of A Gun“ und Dying For It“ noch allerhand Live-Schmankerl aus Bristol und London. Dazu ein paar unveröffentlichte Demos und natürlich das Album „Dum Dum“, das Ende der 80er das Licht der Welt erblickte. Eine schöne Überraschung, wie auch der Umstand, dass die Band im letzten Jahr bei der Party zum 20jährigen ihres superben Labels „Sub Pop“ reuniert auf der Bühne stand. Das ganze Material, das ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wurde derweil von Tape- auf Cd-Qualität aufgestockt. Der raue Charme der Musik, der zeitweise klar macht, wo Kimya Dawson und Adam Green wohl eine ganze Menge ihres Sounds abgebauscht haben, bleibt dabei größtenteils erhalten. Man kann sich auch anno 2009 noch hervorragend die Jeans zu den Vaselines auframschen und auf einem durchgesessenen Sofa die Zeit an sich vorbei ziehen lassen. Mehr Zeitgeist geht nicht. Die wahrscheinlich nostalgischste Anti-Pop-Versuchung des Frühlings. Nicht nur für Nirvana-Fans ein absolutes Muss im heimischen Plattenregal.
Vorsicht ist derweil geboten, wenn die Außerirdischen von den Brakes zum Landeanflug ansetzen. „Touchdown“ – das neue Album von den Jungs punktet vor allem mit schicken Melodien, die wahrscheinlich überall rauf und runter liefen, gäbe es in Deutschland eine College-Radio-Szene. Schmissige und hymnische Hits der Marke „Don´t Take Me To Space (Man)“ oder das brachiale „Red Flag“, das in seiner Atemlosigkeit fast schon an die 11 Sekunden Watschen, die sie einst Dick Cheney im Mini-Song-Format verabreichten, erinnert, sorgen dafür, dass der Hörer bis zum Ende bei der Stange bleibt. Vertracktes Songwriting geht anders, macht aber nix bei solch einer Stilvielfalt. Alles darf, nichts muss. Soll heißen: die Brakes bleiben unberechenbar. Spielen sich durch beschwingte Sommerpop-Hits, die von den Lemonheads sein könnten („Worry About It Later“) oder machen in „Eternal Rush“ den Emo-Helden von den Get Up Kids Konkurrenz. Brakes bleiben auch anno 2009 das schönste Nebenprojekt der britpoppigen Garde. Und sorgen mit „Touchdown“ für kurzweilige 36 Minuten Partyatmosphäre zum Seele baumeln lassen. Was könnte in frühlingshaften Tagen schöner sein?
The Juan MacLean scheinen derweil keine großen Zweifel zu haben: „The Future Will Come“ postulieren sie/er auf ihrem/seinem aktuellen Album und erzeugen mit der Musik einen Eindruck davon, wie selbige wohl klingen könnte. Nach dem ersten Durchlauf ist man zunehmend verwundert. Ziemlich protzig, fast schon hittig ist die Scheibe geraten. Hätte man ja durchaus mit rechnen können, wenn man weiß, dass der Maestro neben Sounds von Daft Punk auch schon Musik von Air remixte. Aber ein solch blitze blankes Soundgewand hätte man ihm dann doch nicht zugetraut. Der Teufel dieser Platte steckt also… wie sagt man so schön: im Detail. Nach mehreren Durchläufen fragt man sich dann, ob jenes Detail, sei es nun ein Klacken oder ein Trommelschlag, beim letzten Mal auch schon an der gleichen Stelle saß. Oberflächlich gesehen glänzt der Sound -The Human League lassen als Referenz grüßen- aber unter der Oberfläche, da spürt man eine gewisse Verweigerungshaltung: Vielleicht ist das ja die No Wave-Geste aus MacLeans Zeit als Gitarrist von Six Finger Satellite. Man kommt jedenfalls nicht umhin, ihm zu unterstellen, er untergrabe den Popaspekt seiner Musik. Das Bemerkenswerte dabei ist: diese Dissonanzen erzeugen hier in gewisser Weise eine besondere Dynamik. Sie verbrüdern sich mit der großen Geste. Kurz gesagt: sie befeuern den Pop-Moment. In einer Zeit, in der es unmöglich ist, musikalisch noch anzuecken, geht Juan MacLean dabei nicht etwa den Weg des geringsten Widerstands. Er versetzt dem Hörer lieber kleine Stiche. Die Musik scheint in ihrer Formvollendung immer mit einem gewissen Augenzwinkern behaftet. So als wollte er das System von innen heraus zerstören.
Wer derweil noch auf der Suche nach dem passenden Soundtrack zum Frühling 2009 ist, der sollte sich mal das neue Album von Bishop Allen reinziehen. Das Grummeln des süßen Kätzchens auf dem Frontcover bleibt nur schwer nachzuvollziehen, wenn die Musik losläuft. „Grrr…“ steckt voller bemerkenswert arrangierter Popperlen. Ben Folds hat hier genauso seine Spuren hinterlassen, wie Spoon oder die Kinks und weil der liebe Bishop erst kürzlich in einem Hollywood-Blockbuster aufgetreten ist, steht dem großen Durchbruch eigentlich nichts mehr im Wege. Immer dort, wo die weinerliche Folk-Fraktion die Tränendrüse bedient, da schlägt der liebe Mr. Allen sanfte Haken und spurtet vom Dunkel ins Licht. Die Songs strahlen so eine gewisse Leichtigkeit aus. Sie verkommen aber nie zu solch plumpen Radiopop, wie ihn Ben Lee hin und wieder fabriziert. Dass er diesen Spagat so gekonnt hinkriegt, kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Da sei ihm auch verziehen, dass er seine Musik hin und wieder für Werbemaßnahmen hergibt.
Mintzkov Luna würde man hinterher auch ganz toll wünschen, dass sie endlich die breite Masse von sich überzeugen. Das neue Album „M For Means And L For Love“ ist eigentlich das beste Blackmail-Album, das die Jungs aus Koblenz seit „Bliss, Please“ nicht mehr geschrieben haben. Das beflügelte Herz auf dem Cover überschlägt sich mit dem des Hörers um die Wette. Das hier ist einfach nur zuckersüßer Indie-Pop mit einer großen Portion Gitarrenpower. Romantisch sein können die Jungs aber auch ganz gut, was sie mit dem balladesken „I Do“ bravourös unter Beweis stellen. Das Quartett aus Lier stand unter anderem schon mit Sophia auf der Bühne und musikalisch würde sich vielleicht auch ein Duett mit Slut anbieten. So formvollendet wie hier bekommt man jedenfalls in diesen Tagen kaum noch zeitgemäßen Indie-Rock verabreicht. Da schlummern irgendwo auch dEUS als Einfluss zwischen den watteweichen Melodien. Kurz gesagt: In jeder Indie Disco des Landes müssen demnächst Wasserspender installiert werden. Nach dieser exzessiven Vollbedienung braucht man erstmal eine kühle Dusche. Hinterher kann man sich ja dann zu „United Something“ knutschend aufs Sofa verziehen. Wenn die Jungs von Placebo da mal nicht neidisch werden.
Den Garagenrockern von Division Of Laura Lee war derweil ja leider nicht der große Erfolg vergönnt. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie ihn die schwedischen Landsmänner von den Hives oder The (International) Noise Conspiracy einfahren konnten. Jetzt starten sie einen neuen Anlauf in die Gehörgänge der Partyfraktion. „Violence Is Timeless“ geht ziemlich euphorisch los. „Caress/Hotnights“ ist ein echter Tanzflächenfüller. Und auch der Rest der Scheibe punktet mit entspannten Melodien und verrockter Attitüde. Gegensätze ziehen sich an und so lebt dieses Album von der Dynamik, die ihm innewohnt. Sowohl Fans von den Foo Fighters, als auch Anhänger von Joy Division dürften sich in dem ein oder anderen Stück wieder erkennen. Die schwedische Punkrockcombo um Per Stålberg, Jonas Gustafsson, Håkan Johansson und David Ojala, deren Namen sich auf die Soulsängerin Laura Lee bezieht, weiß, wie man den Hörer bei der Stange hält. Mit etwas Glück könnte ihnen dieses Album noch mal ganz gehörig Auftrieb in Sachen Breitenwirksamkeit geben. Mit dem letzten Werk der Hives können sie jedenfalls locker mithalten. Schade nur, dass die Qualität der Musik heutzutage nur noch bedingt über den Erfolg in den Charts entscheidet.
Darauf geht’s dann erstmal auf zum Ballermann. „Ob Festzelt oder Großraumdisco…“ … Misses Next Match… aus Hamburg können mit beiden ganz gut. Dabei will ihr Sound zu keiner der beiden Alternativen so richtig passen. Die Band gibt sich zwar alle Mühe, auf die Kacke zu hauen, aber so richtig peinlich wird’s nie. Punkten können sie derweil mit dem Songtitel „Wer neu ist im Fight Club muss kämpfen“ oder dem Elektro-Synthie-Hüpfer„Ein Gespür“. Kurz gesagt: Verarscht! Das hier ist Pulver für die Cd-Beschallungsmaschine im Indie-Club. Die Mucke ist Glitzerstaub auf dem Gemüt des unermüdlichen Tänzers, der sich auch zu Saalschutz und Knarf Rellöm im Takt windet. Tiefsinnig. Poppig. Stellenweise gar großartiger Elektro-Pop mit Betonung auf der zweiten Silbe. Mit jedem Durchlauf schließt man diese Scheibe tiefer ins Herz. Am Ende zählt eben immer nur das blanke Ergebnis. In diesem Fall ein Sieg in zweistelliger Höhe. Misses Next Match… deklassieren die Konkurrenz aus New Rave Gehegen. Sie machen Pop mit Hirn. Festzelt und Großraumdisco können sie sonst mal… also mehr davon bitte.
Und hinterher dann mal geschaut, was der liebe Tiga so beizutragen hat zur elektronischen Tanzbodenbeschallung. „Ciao!“ klingt ja auf den ersten Blick wie ein Abgesang. Gegebenenfalls kann man es aber auch zur Begrüßung verwenden. Ein Durchlauf später ist klar. Da geht einiges. Funkpop mit elektronischer Breitseite und Störgeräuschen wandelt da auf der Schwelle zum Clubtrack. Soll heißen: Stell dir vor Josh Wink und Prince treffen sich im Studio und kämpfen um die Vorherrschaft am Mischpult. Dann würde da wohl in etwa ein Track, wie „Mind Dimension“ rauskommen. Die Tracks sind allesamt sehr tanzbar geraten. Bewegen sich irgendwo im Grenzgebiet zwischen LCD Soundsystem und Disco-Keule. Alles ist erlaubt und so entwickelt sich der Zweitling des Montrealer Künstlers zum referenziellen Ballerspiel, das mit 80er Jahre-Anleihen und hohem Hitappeal nur so um sich schießt. Alles in allem gelingt es dem Musiker über weite Strecken die unterschiedlichen Einflüsse gekonnt miteinander zu verweben. Wer allerdings auf die eher subtilen Scheiben der Pet Shop Boys steht, könnte sich am impulsiven Sound eines Tracks, wie „Luxury“ durchaus die Zähne ausbeißen. Alles in allem ein imposantes Tanzalbum mit hoch gepischtem Hitpegel. Hoffen wir, dass die Euphorie noch lange anhält… und damit „ciao“, bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
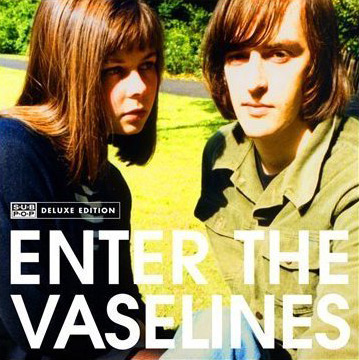 „Enter
„Enter 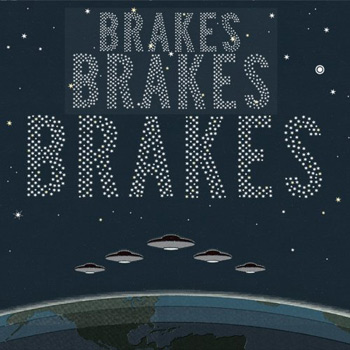 Vorsicht ist derweil geboten, wenn die Außerirdischen von den
Vorsicht ist derweil geboten, wenn die Außerirdischen von den  The Juan MacLean
The Juan MacLean Wer derweil noch auf der Suche nach dem passenden Soundtrack zum Frühling 2009 ist, der sollte sich mal das neue Album von
Wer derweil noch auf der Suche nach dem passenden Soundtrack zum Frühling 2009 ist, der sollte sich mal das neue Album von  Mintzkov Luna
Mintzkov Luna Den Garagenrockern von
Den Garagenrockern von  Darauf geht’s dann erstmal auf zum Ballermann. „Ob Festzelt oder Großraumdisco…“ …
Darauf geht’s dann erstmal auf zum Ballermann. „Ob Festzelt oder Großraumdisco…“ … 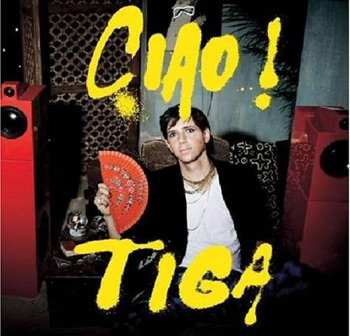 Und hinterher dann mal geschaut, was der liebe
Und hinterher dann mal geschaut, was der liebe
UND WAS NUN?