Jetzt mal im ernst. Sportfreunde Stiller sind zwar immer noch der heißeste Scheiß, wo gibt, aber die letzten Alben waren doof. Die Texte gerieten dermaßen plakativ, dass man sich fragen musste, ob das jetzt immer noch geil ist, oder ob der Punkt schon erreicht ist, wo eine gewisse Sättigung eintritt. Da geht doch nix mehr. Immer die gleiche, alte Leier. Da können die Jungs noch so sympathisch sein, die Hymnen der ersten Jahre sind Kalauern für die Bierzeltfraktion gewichen. Vielleicht liegt aber auch darin das Geheimnis, dass die Jungs inzwischen so breitenwirksam abgehen: Dass sie einfach von allen gemocht werden. Natürlich auch von MTV. Die haben jetzt bei den Münchnern angeklopft und auch wenn ich es mir nicht so richtig vorstellen konnte, die Sportis in „unplugged“ (Was immer das auch heißen soll?). Whatever. Sie haben den Kritiker in mir zum Schweigen gebracht. Ich hab mich selten so gefreut, Tracks wie „Fast wie von selbst“ und das unglaubliche „Wie lange sollen wir noch warten?“ in runderneuerten Versionen wiederzuhören. Dazu dann noch ein schickes Feature von den Subways beim Smash-Hit „Rock´n´Roll Queen“ und das Bläsergebilde „Der Titel vom nächsten Kapitel“. Das kann man alles viel, viel schlechter machen. Die Sportis aber kriegen die Kurve. Das nölende „Akustik Avenue“-Zwischenrufen in „Ein Kompliment“ hätte man sich zwar sparen können, aber sonst geht „MTV Unplugged in New York“ mehr als in Ordnung. So in Ordnung sogar, dass diejenigen, die sich zuletzt vielleicht „Die gute Seite“ von den Jungs zugelegt haben, ihre ehemalige Lieblingsband wieder aufs Neue ins Herz schließen. Wie sagt man so schön: „Wunder gibt es immer wieder“. Und apropos. Schlager gibt’s diesmal auch. Zusammen mit Udo Jürgens. „Ich war noch niemals in New York“. Und da ist das Album dann auch nicht entstanden. Ist eben ihre Art von Humor. Mag man oder eben nicht. Ich komm so langsam wieder rein.
Und dann mal geguckt, was in dunkleren Nächten so auf den Plattenteller geschmissen wird. Isis waren ja noch nie eine Band, die groß dazu bereit gewesen wäre, Zugeständnisse an gängige Pop-Schemata zu machen. Isis standen Zeit ihrer Existenz für einen alternativen Musikentwurf. Für Songs, die sich jeglichem Formatdenken verweigerten. Auch wenn sich Sänger und Gitarrist Aaron mit den Jahren immer mehr den melodiösen Facetten seiner Stimme zuwandte und dafür den grölenden Dampfhammer in der Tasche verrecken ließ. Isis waren, ob sie nun in Doom-Gefilden oder im Post-Hardcore-Bereich wilderten… sie waren etwas ganz Besonderes. Eine Ausnahmeerscheinung. Eine Band, die Grenzen einriss, obwohl sie sich schon längst abseits jeglicher Begrenzungen bewegte. Nun also haben Isis nach 12 Jahren Bandgeschichte ihr neues Album eingespielt. Sieben Songs, entstanden mit freundlicher Unterstützung von Tools Adam Jones, die keine Wünsche offen lassen. Die wirken, als würde man einen pechschwarzen Farbtopf auf eine weiße Fläche schmettern. Die ebenso brachial, wie dynamisch, wie melodiös klingen und dabei zu einer formvollendeten Einheit verschmelzen. Über Musik, wie dieser zu schreiben, ist undankbar, es ist bisweilen unmöglich. Die Metaphern vom apokalyptischen Moment, vom brachialen Gitarrengewitter sind allesamt ausgelutscht, wie Muschelschalen. Deswegen folgt meiner Ansage: Einfach mal eine Stange Geld in eine gute Anlage investieren. Sich ins Zentrum der perfekt ausgepegelten Boxenlandschaft setzen und abwarten, bis „Wavering Radiant“ einen förmlich überrollt mit seiner Eleganz. Danach schmeißt du deine Festplatte mit MP3s aus dem Fenster und fragst dich, warum du dich jemals mit Weniger zufrieden gegeben hast. 54 Minuten und acht Sekunden reine Brillanz. Die anderen aus dem Postrockbereich werden sich umschauen, dass sie da noch hinterherkommen.
Nach ausufernden Klängen kann man bei Jack Beauregard, dem Kölner und Berliner Synthie-Pop-Duo, lange suchen. Die beiden fokussieren sich lieber auf den geradlinigen Popsong. Das kommt an. Vor allem, weil sie im Kontext eines Indie-Clubs und direkt nach der neuen Single von Phoenix aus den Boxen geballert, geradewegs dazu einladen, völlig auszuflippen. „Anyone Around“ ist so ein Ding, das einen einwickelt mit seiner Glückseligkeit. Natürlich geht’s auch hin und wieder etwas gemächlicher zu. Manchmal wird’s sogar folkig. Aber trotzdem stehen am Schluss alle glücklich in der Gegend rum und freuen sich über diesen sympathischen Grenzgänger zwischen Belle & Sebastian, Jose Gonzales, The Whitest Boy Alive und Fischerspooner. Getreu dem Motto: „Everyone Is Having Fun“. Bitte mal reinhören. Ein kleines, aber feines Elektrofolk-Schmankerl.
Die Eels machen sich derweil daran ihrem eh schon mannigfaltigen Output ein weiteres Puzzleteil hinzuzufügen. „Hombre Lobo“ gibt im Untertitel die Richtung bereits vor: „12 Songs Of Desire“ sollen es sein und mal wieder hört man den Einfluss von Tom Waits krächzen. Dazu die eine oder andere verpunkte Breitseite der Marke „Lilac Breeze“ und schon ist man drin in der Welt von Mark Oliver Everett alias E. Der sympathische Kauz scheint mit dem Alter immer kreativer zu werden. An Abwechslungsreichtum und schönen Melodien setzt sich dieses Album nämlich mal aus dem Stand an die Spitze des Eels-sen Schaffens. Dass bei manchem Song eine gewisse Altersmilde einkehrt, ist deshalb auch schnell wieder verziehen. Vielmehr verleihen die ruhigen Momente dem Maestro etwas Erhabenes. Getragene Stücke wie „In My Dreams“ und „The Longing“ sind vor allem eins: reine Magie. „Hombre Lobo“ ist ein melancholischer Abgesang auf die Liebe. Ein nahezu verzweifeltes Album. Aber auch eines, dass mit „Fresh Blood“ den schönsten Sommerhit der sagen wir mal Post-„From Dusk Til Dawn“-Ära mitbringt. In „Beginner´s Luck“ wird zudem kurz vor Ende dann doch noch alles gut. Back To The Basics – zurück in die Zukunft. Ein Wahnsinn, dieser Typ, der mit seinen letzten Worten gar nicht richtiger liegen könnte. „I´m No Ordinary Man“… Ja, verdammt! Und das ist auch scheiße noch mal gut so.
Ebenfalls verdammt gut ist die neue Scheibe aus dem Hause Ladyfinger (ne). Die schlagen im Opener „Over And Over“ gleich mal auf ihre Instrumente ein, dass man meint, sie wollten alte Grunge-Zeiten mit einem Schuss Emo-Rock ins Hier und Jetzt überführen. Fans von den Foo Fighters bis hin zu Minus The Bear dürfte das Wasser im Munde zusammen laufen. Die ganze Scheibe ist ein einziger Hit-Knebel, der einem den Schweiß aus den Poren quetscht. Man kann regelrecht nachfühlen, wie die Jungs im Proberaum ihren Spaß gehabt haben. Sie machen sich keine großen Gedanken um die große Kohle. Ladyfinger sind nicht die hippen Nachzügler, die da gerade aus den Proberäumen auf die Mattscheibe von MTV klettern. Die Jungs wirken eher so, als wären sie völlig durchgerockt von der Tanzfläche auf die Bühne gestolpert, hätten ihre Instrumente eingestöpselt und einfach mal drauf losgespielt. Dementsprechend geerdet wirkt das Album. Der Sound ist schroff, die Melodien reißen einem das Herz raus und jeder Versuch, den Jungs einen bestimmten Stempel aufzudrücken, scheitert an der Entschlossenheit der Protagonisten, ein richtig geiles Rockalbum abzuliefern. „Dusk“ ist ein Lichtblick im Dschungel der glatt produzierten Einheitsbrei-Combos. Da hätten gut und gerne noch mehr als zehn Songs drauf Platz gehabt.
Schnörkellosen Emo-Rock mit Pop Punk-Breitseite fabrizieren hinterher You Me At Six auf ihrem Debütalbum „Take Off Your Colours“. Soundtechnisch sind die Jungs so dermaßen up to date, dass es nicht lange dauern dürfte, bis ihre Musik auch hierzulande komplett durch die Decke geht. Dass sie zudem nicht aus den USA stammen, wo Sounds wie diese an der Tagesordnung sind, sondern aus dem lieben England, verschafft ihnen einen gewissen Exoten-Bonus. Hier dreht sich alles um Sommersonne und Badestrand. Zumindest soundtechnisch feiert die Band den Moment. Hat eine gute Zeit im Sinne von Jimmy Eat World, The Ataris und Samiam. Das Album wurde zwar am Ende vielleicht eine Spur zu glatt gebügelt, aber die Songs machen trotzdem viel Spaß. Gerade wenn man sie mit den üblichen Verdächtigen Marke Hawthorne Heights, Fall Out Boy und Aiden vergleicht, ist hier doch eine gewisse Rotznäsigkeit zu spüren, die immer wieder die eine oder andere freche Melodie abwirft. Alles in allem der perfekte Soundtrack, um das Schiebedach zu öffnen und sich mit dem Schleudersitz in den Pool des Nachbarn zu schießen. Mit Arschbombe versteht sich.
Ein dahin gerotztes Rockalbum mit einer Prise Dylan-Nostalgie hauen uns hinterher Mattias Hellberg & The White Moose um die Ohren. Der ehemalige Hellacopters Gitarrist dreht gleich zu Beginn mit dem famosen Auftakt-Hit „Black Cat Fever“ ordentlich auf, um sich anschließend in akustische bis psychedelische Eskapaden zu stürzen, die immer eins gemeinsam haben: sie wirken spontan – wie ein One Take. So, als hätten sie sich eine Stunde aus dem Leben verabschiedet, ihre Instrumente eingestöpselt und dann einfach mal drauf los gespielt. „Out Of The Frying Pan Into The Woods“ ist ein seltsames, wie aus der Zeit gefallenes Werk, das einen mit jedem Durchlauf nostalgischer stimmt. Altbacken klingt die Scheibe dabei nicht. Dazu ist sie viel zu bezaubernd. Hat man es sich erstmal mit den Songs gemütlich gemacht, kann man gar nicht genug von der Mucke bekommen. Schade nur, dass der Spuck schon nach zehn Songs vorbei ist. Aber wofür gibt’s denn Repeat?! Ne eben…
Der liebe Conor Oberst, seines Zeichen Frontmann von Bright Eyes, hat derweil so etwas wie ein zweites Soloalbum veröffentlicht. Keine Ahnung, wo der Junge die ganze Ideen her nimmt, aber auf „Outer South“, das er zusammen mit der Mystic Valley Band eingespielt hat, finden sich mal wieder keinerlei Ausfallerscheinungen. Ganz im Gegenteil. Bei dem Musiker scheint sich mit zunehmendem Alter eine gewisse Leichtigkeit einzuschleichen. Seine Musik könnte gar nicht weiter weg sein vom frühen Tränendrüsen-Image des Künstlers. Die 16 Songs wirken nahezu wie beschwingte Blütenblätter, die sich in der Sommersonne ein wohl verdientes Bad genehmigen. Nicht zu verwechseln allerdings ist das Ganze hier mit dem plakativen Country-Allerlei, dass da sonst so aus den USA zu uns herüber schwappt. Eher sollte der liebe Conor vielleicht mal darüber nachdenken, ein Duett mit Ryan Adams einzuspielen. Der hat ja einen ebensogroßen Output, wie der Herzensbrecher aus Omaha und noch dazu kann er auch qualitativ mit ihm mithalten. Ein schönes, schnörkelloses, oftmals zurückgelehntes Country-Rock Album, dass mit „Nikorette“, „To All The Lights In The Windows“ und „Worldwide“ vor Hits nur so strotzt. Und das sage ich, als jemand, dem Country mit Ausnahme von Johnny Cash völlig am Arsch vorbei geht. Womit wir auch schon am Ende wären. Wir lesen uns. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
 Jetzt mal im ernst.
Jetzt mal im ernst.  Und dann mal geguckt, was in dunkleren Nächten so auf den Plattenteller geschmissen wird.
Und dann mal geguckt, was in dunkleren Nächten so auf den Plattenteller geschmissen wird.  Nach ausufernden Klängen kann man bei
Nach ausufernden Klängen kann man bei 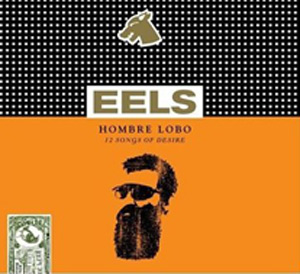 Die
Die  Ebenfalls verdammt gut ist die neue Scheibe aus dem Hause
Ebenfalls verdammt gut ist die neue Scheibe aus dem Hause  Schnörkellosen Emo-Rock mit Pop Punk-Breitseite fabrizieren hinterher
Schnörkellosen Emo-Rock mit Pop Punk-Breitseite fabrizieren hinterher  Ein dahin gerotztes Rockalbum mit einer Prise Dylan-Nostalgie hauen uns hinterher
Ein dahin gerotztes Rockalbum mit einer Prise Dylan-Nostalgie hauen uns hinterher 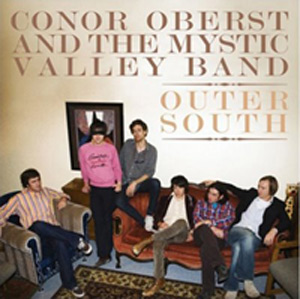 Der liebe
Der liebe
UND WAS NUN?