mit dem Werk „Ginsterburg“ von Arno Frank.
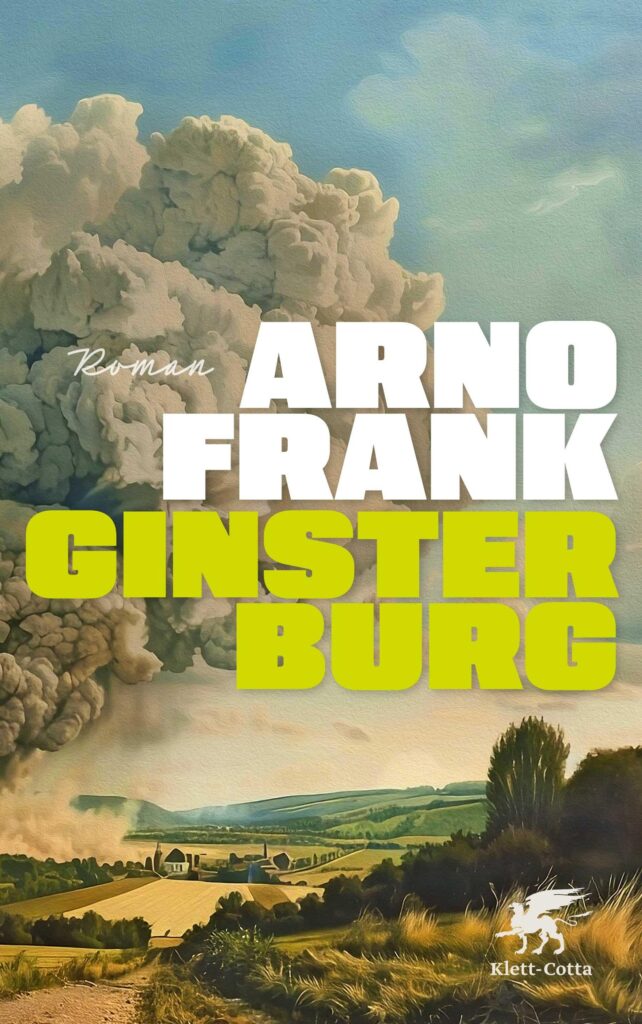
// Es ist eines dieser Bücher, bei denen man schon nach zwanzig Seiten weiß: Das wird bleiben. Nicht, weil es laut wäre oder besonders drastisch, sondern gerade weil es leise erzählt – mit einem Blick, der sich nicht wegdreht, aber auch nicht sensationslüstern glotzt. Ginsterburg, der neue Roman von Arno Frank, ist wie ein Film in Schwarzweiß, in dem die Farben langsam durchbluten. Und am Ende ist man erschöpft, bewegt, vielleicht sogar ein bisschen verändert. Die fiktive Stadt Ginsterburg ist ein Mikrokosmos – und wie jeder Mikrokosmos ein Spiegel. Arno Frank siedelt seinen Roman in den Jahren 1935 bis 1945 an, in der Provinz, dort, wo die großen Parolen auf kleine Leben treffen. Man kennt die großen historischen Linien. Doch was dieser Roman tut – und das mit einer fast beängstigenden Präzision –, ist, das Ungeheuerliche im Gewöhnlichen zu zeigen. Es beginnt mit Lothar, einem Jungen, der fliegen will. Und fliegen heißt in dieser Zeit auch: marschieren, salutieren, dazugehören.
Dass dieser kindliche Traum so gefährlich wird, merkt man erst nach und nach – genau wie Lothars Mutter Merle, die in ihrer kleinen Buchhandlung Bücher verkauft, von denen sie weiß, dass sie bald nicht mehr verkauft werden dürfen. Sie ist keine Heldin, keine Widerstandskämpferin. Sie ist einfach nur eine Frau mit Herz, Verstand – und Angst. Und gerade deshalb ist sie so nah. Und dann sind da all die anderen Figuren, die Arno Frank mit kluger Hand zeichnet, nie überhöht: der sich einschmeichelnde Blumenhändler Gürckel, der joviale, aber gnadenlose Arzt Hansemann, der schweigende Journalist Eugen, dessen Haltung so leise ist, dass sie fast untergeht. Es ist eine stille Tragik, die sich durch das Buch zieht: Wie das Neue, das sich als Ordnung tarnt, langsam Besitz ergreift von den Menschen – in ihren Gesten, in ihrer Sprache, in ihren Entscheidungen. Frank schreibt in einer Sprache, die gleichzeitig poetisch und präzise ist. Kein Wort zu viel, aber immer mit Resonanz. Er lässt Stimmungen stehen wie Bilder in der Abenddämmerung. Man meint, die staubige Straße in Ginsterburg zu riechen, das Flirren der Hitze über den Feldern zu sehen, das Flackern der Kinoleinwand zu hören. Und immer schleicht sich der Schatten näher, unaufhaltsam – bis er mitten im Leben angekommen ist. Was Ginsterburg so stark macht, ist, dass es keine klare Aufteilung in Gut und Böse gibt. Es gibt Menschen, die zweifeln, Menschen, die sich blenden lassen, Menschen, die schweigen, obwohl sie wissen. Und es gibt Menschen, die überleben wollen – irgendwie, auf Kosten anderer, mit dem Rücken zur Wand. Manchmal fragt man sich beim Lesen: Was hätte ich getan? Die vielleicht bewegendsten Szenen sind die kleinen. Ein stummes Gespräch zwischen Mutter und Sohn. Ein Brief, den niemand beantworten kann. Ein Abend im Kino, der für einen Moment Frieden vorgaukelt. Und dann der Blick auf die Stadt von oben – aus dem Cockpit eines britischen Bombers, der sich nähert, langsam, unausweichlich. Ginsterburg ist kein historischer Roman im klassischen Sinn. Es ist vielmehr ein Roman über den Menschen im Sog der Geschichte. Über das Mitläufertum, das nicht brüllt, sondern leise nickt. Über Schuld, die nicht in einem einzigen Moment entsteht, sondern in vielen kleinen Kompromissen. Und über das, was übrig bleibt, wenn alles vorbei ist – an Erinnerungen, an Fragen, an Schmerz. Ich habe dieses Buch mit angehaltenem Atem gelesen. Weil es schmerzt. Weil es wahr ist – auch wenn es erfunden ist. Und weil es eine Geschichte erzählt, die nicht vergangen ist. Nicht wirklich. Wer sich darauf einlässt, bekommt keinen moralischen Zeigefinger, sondern einen Spiegel. Und vielleicht ist das das Beste, was Literatur tun kann.
UND WAS NUN?