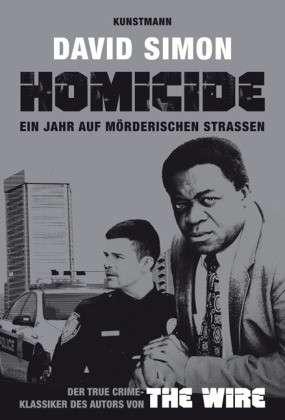 Die Polizeiserie „The Wire“ wird von zahlreichen renommierten Kritikern zu den besten Serien aller Zeiten gezählt. In den fünf Staffeln wird das Leben auf Baltimores Straßen umrissen, wobei es durchaus bemerkenswert ist, dass jede Staffel sich diesbezüglich einer anderen Hierarchie-Ebene des Gang- und Polizeilebens widmet. So bekommt man als Zuschauer ein detailliertes und äußert differenziertes Bild davon vermittelt, wie in dieser Stadt das Polizeileben organisiert ist und welche Rolle das organisierte Verbrechen und die Politik dabei einnehmen. Nun erscheint im „Kunstmann“-Verlag eines der beiden Bücher, die dafür herhalten mussten, Baltimores Geschichte auf die Leinwand zu transferieren. „Homicide – Ein Jahr auf mörderischen Straßen“ umreißt das Leben in einer Stadt, in welcher pro Jahr über 200 Morde begangen werden. Autor David Simon gelingt es in diesem Zusammenhang nicht nur den Slang der Straße aufs Papier zu bringen, sondern auch die sozialpolitischen Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Bemerkenswert daran ist vor allem die augenscheinliche Hoffnungslosigkeit, die sich bei allen Protagonisten einzuschleichen scheint. In einer Welt, in welcher die Moral schon lange kein Bezugspunkt mehr ist, verschwimmen auf diese Weise die Grenzen zwischen Gut und Böse. David Simon, von Beruf wegen Journalist und ehemaliger Polizeireporter der „Baltimore Sun“, hätte es sich in diesem Zusammenhang durchaus leicht machen können: der Autor widersteht aber der Versuchung zweidimensionale Charaktere zu kreieren. Stattdessen werden die Nöte und Zwänge der Protagonisten glaubwürdig überliefert, was auch daran liegen dürfte, dass Simon zu Recherchezwecken ein Jahr lang ganz eng mit den öffentlichen Behörden zusammenarbeitete. Am Ende lässt er sich trotzdem nicht dazu verleiten, den Blickwinkel der Ermittler vollends zu übernehmen. Er spielt sich nicht als Richter auf, sondern möchte die unterschiedlichen Facetten und Zusammenhänge des „Tatorts Baltimore“ aufzeigen. Schon in Kürze wird deshalb im „Kunstmann“-Verlag ein weiteres seiner Bücher erscheinen. Unter dem Namen „The Corner“ setzt er sich mit dem Leben auf der Straße und den Gangs der Stadt auseinander und man darf gespannt sein, ob es ihm gelingt, ein ebenso umfassendes, wie verständliches Gesamtbild des illegalen Treibens an den Straßenecken zu entwerfen. Mit „Homicide“ gelingt David Simon die glaubwürdige Darstellung eines fragwürdigen Systems, welches jeglichen Funken Hoffnung im Keim zu ersticken scheint.
Die Polizeiserie „The Wire“ wird von zahlreichen renommierten Kritikern zu den besten Serien aller Zeiten gezählt. In den fünf Staffeln wird das Leben auf Baltimores Straßen umrissen, wobei es durchaus bemerkenswert ist, dass jede Staffel sich diesbezüglich einer anderen Hierarchie-Ebene des Gang- und Polizeilebens widmet. So bekommt man als Zuschauer ein detailliertes und äußert differenziertes Bild davon vermittelt, wie in dieser Stadt das Polizeileben organisiert ist und welche Rolle das organisierte Verbrechen und die Politik dabei einnehmen. Nun erscheint im „Kunstmann“-Verlag eines der beiden Bücher, die dafür herhalten mussten, Baltimores Geschichte auf die Leinwand zu transferieren. „Homicide – Ein Jahr auf mörderischen Straßen“ umreißt das Leben in einer Stadt, in welcher pro Jahr über 200 Morde begangen werden. Autor David Simon gelingt es in diesem Zusammenhang nicht nur den Slang der Straße aufs Papier zu bringen, sondern auch die sozialpolitischen Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Bemerkenswert daran ist vor allem die augenscheinliche Hoffnungslosigkeit, die sich bei allen Protagonisten einzuschleichen scheint. In einer Welt, in welcher die Moral schon lange kein Bezugspunkt mehr ist, verschwimmen auf diese Weise die Grenzen zwischen Gut und Böse. David Simon, von Beruf wegen Journalist und ehemaliger Polizeireporter der „Baltimore Sun“, hätte es sich in diesem Zusammenhang durchaus leicht machen können: der Autor widersteht aber der Versuchung zweidimensionale Charaktere zu kreieren. Stattdessen werden die Nöte und Zwänge der Protagonisten glaubwürdig überliefert, was auch daran liegen dürfte, dass Simon zu Recherchezwecken ein Jahr lang ganz eng mit den öffentlichen Behörden zusammenarbeitete. Am Ende lässt er sich trotzdem nicht dazu verleiten, den Blickwinkel der Ermittler vollends zu übernehmen. Er spielt sich nicht als Richter auf, sondern möchte die unterschiedlichen Facetten und Zusammenhänge des „Tatorts Baltimore“ aufzeigen. Schon in Kürze wird deshalb im „Kunstmann“-Verlag ein weiteres seiner Bücher erscheinen. Unter dem Namen „The Corner“ setzt er sich mit dem Leben auf der Straße und den Gangs der Stadt auseinander und man darf gespannt sein, ob es ihm gelingt, ein ebenso umfassendes, wie verständliches Gesamtbild des illegalen Treibens an den Straßenecken zu entwerfen. Mit „Homicide“ gelingt David Simon die glaubwürdige Darstellung eines fragwürdigen Systems, welches jeglichen Funken Hoffnung im Keim zu ersticken scheint.
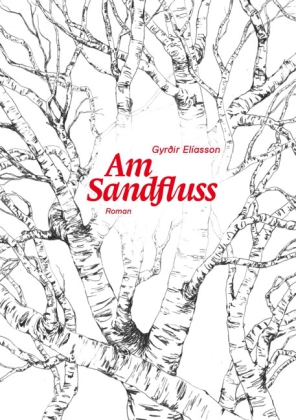 Ein Buch über einen Mann zu schreiben, der sich dazu entschlossen hat, nach seiner Scheidung in der Natur Islands zu leben, das klingt im ersten Moment so, als müsste man sich den zehnstündigen Extented-Cut von „Into The Wild“ zu Gemüte führen. Dabei ist es am Ende gerade die Gemächlichkeit von Gyrðir Elíasson, die einen im wahrsten Sinne des Wortes aus der Bahn wirft. Mit welch schlichten Mitteln er den Leser in seinen Roman „Am Sandfluss“ bei der Stange hält, ist schlicht bravourös. Man möchte sich irgendwo in ein altes Bettlaken einwickeln und die Welt um sich herum vergessen. Der Roman, der völlig zu recht erst in diesem Jahr mit dem „Nordischen Literaturpreis“ ausgezeichnet wurde, entwickelt sich zu einem mysteriösen Monster, dessen bedrohliches Finale sich schon nach wenigen Seiten abzuzeichnen scheint. Irgendwas stimmt hier nicht, möchte man als Leser regelrecht dazwischen rufen, während sich der Protagonist daran macht, den Wald um ihn herum in ein Portrait zu überführen. In diesem Zusammenhang wird vor allem unser verwahrlostes Verhältnis zur Natur deutlich. Eine diffuse Angst schleicht sich ein… deren Ursprung es nach und nach zu erkunden gilt. All das schwingt allerdings eher unterschwellig mit. Es ist nicht auszumachen, was dieses Gefühl beim Leser auslöst. Alles schwebt so ein bisschen zwischen den Zeilen. Und eben deshalb sollte man sich „Am Sandfluss“ auf keinen Fall entgehen lassen.
Ein Buch über einen Mann zu schreiben, der sich dazu entschlossen hat, nach seiner Scheidung in der Natur Islands zu leben, das klingt im ersten Moment so, als müsste man sich den zehnstündigen Extented-Cut von „Into The Wild“ zu Gemüte führen. Dabei ist es am Ende gerade die Gemächlichkeit von Gyrðir Elíasson, die einen im wahrsten Sinne des Wortes aus der Bahn wirft. Mit welch schlichten Mitteln er den Leser in seinen Roman „Am Sandfluss“ bei der Stange hält, ist schlicht bravourös. Man möchte sich irgendwo in ein altes Bettlaken einwickeln und die Welt um sich herum vergessen. Der Roman, der völlig zu recht erst in diesem Jahr mit dem „Nordischen Literaturpreis“ ausgezeichnet wurde, entwickelt sich zu einem mysteriösen Monster, dessen bedrohliches Finale sich schon nach wenigen Seiten abzuzeichnen scheint. Irgendwas stimmt hier nicht, möchte man als Leser regelrecht dazwischen rufen, während sich der Protagonist daran macht, den Wald um ihn herum in ein Portrait zu überführen. In diesem Zusammenhang wird vor allem unser verwahrlostes Verhältnis zur Natur deutlich. Eine diffuse Angst schleicht sich ein… deren Ursprung es nach und nach zu erkunden gilt. All das schwingt allerdings eher unterschwellig mit. Es ist nicht auszumachen, was dieses Gefühl beim Leser auslöst. Alles schwebt so ein bisschen zwischen den Zeilen. Und eben deshalb sollte man sich „Am Sandfluss“ auf keinen Fall entgehen lassen.
 Leif Gustav Willy Persson, ein schwedischer Krimiautor – außerdem Professor der Kriminologie und Medienexperte-, bis 1977 bei der schwedischen Polizei, welche er wegen Whistleblowing wieder verlassen musste (in diesem Zusammenhang war er aber dennoch für die Überführung eines Prostitutionsrings verantwortlich), hat sich mit „Der sterbende Detektiv“ wieder auf Platz 1 in den Bestsellerlisten geschlichen. Der Autor, den sie alle nur „GW [gewe]“ nennen, ähnelt äußerlich seinem Hauptdarsteller Lars Martin Johansson sehr. Körperlich untersetzt, lieben es beide zu essen und zu trinken. Und obwohl beide bereits die Grenze zum Rentnerdasein überschritten haben (Persson ist Jahrgang 1945), scheinen sie getrieben von ihrer Arbeit und geben sich nicht mit privaten Tätigkeiten in Haus und Garten zufrieden – zumindest so lange, wie sie sich nicht auf Elchjagd begeben. Mit diesem Bild im Hinterkopf ist der Beginn des Romans umso erdrückender: der legendäre Mordermittler Lars M. Johansson erleidet einen Schlaganfall. Nach drei Tagen Koma und einer halbseitigen Lähmung verleiht ihn seine Ärztin durch einen Hinweis auf einen verjährten Mordfall wieder neue Lebenskraft: vor 25 Jahren wurde ein 9-jähriges, iranisches Mädchen brutal ermordet. Mit Unterstützung von Krankenpflegern, ehemaligen Kollegen und seiner eigenen Familie führt der Polizist a. D. seine Untersuchungen fort. Obwohl das Verbrechen so viele Jahre zurück liegt, ist Eile geboten, wenn der Täter noch gefasst werden soll, (VORSICHT SPOILER!) schließlich liegt der Ermittler selbst im Sterben und möchte den Fall noch rechtzeitig vor seinem Ableben lösen. So ergibt sich über 541 Seiten eine durchweg spannende Geschichte, die jeden Krimifan ein paar glückliche Stunden bescheren sollte. (K. Reschke)
Leif Gustav Willy Persson, ein schwedischer Krimiautor – außerdem Professor der Kriminologie und Medienexperte-, bis 1977 bei der schwedischen Polizei, welche er wegen Whistleblowing wieder verlassen musste (in diesem Zusammenhang war er aber dennoch für die Überführung eines Prostitutionsrings verantwortlich), hat sich mit „Der sterbende Detektiv“ wieder auf Platz 1 in den Bestsellerlisten geschlichen. Der Autor, den sie alle nur „GW [gewe]“ nennen, ähnelt äußerlich seinem Hauptdarsteller Lars Martin Johansson sehr. Körperlich untersetzt, lieben es beide zu essen und zu trinken. Und obwohl beide bereits die Grenze zum Rentnerdasein überschritten haben (Persson ist Jahrgang 1945), scheinen sie getrieben von ihrer Arbeit und geben sich nicht mit privaten Tätigkeiten in Haus und Garten zufrieden – zumindest so lange, wie sie sich nicht auf Elchjagd begeben. Mit diesem Bild im Hinterkopf ist der Beginn des Romans umso erdrückender: der legendäre Mordermittler Lars M. Johansson erleidet einen Schlaganfall. Nach drei Tagen Koma und einer halbseitigen Lähmung verleiht ihn seine Ärztin durch einen Hinweis auf einen verjährten Mordfall wieder neue Lebenskraft: vor 25 Jahren wurde ein 9-jähriges, iranisches Mädchen brutal ermordet. Mit Unterstützung von Krankenpflegern, ehemaligen Kollegen und seiner eigenen Familie führt der Polizist a. D. seine Untersuchungen fort. Obwohl das Verbrechen so viele Jahre zurück liegt, ist Eile geboten, wenn der Täter noch gefasst werden soll, (VORSICHT SPOILER!) schließlich liegt der Ermittler selbst im Sterben und möchte den Fall noch rechtzeitig vor seinem Ableben lösen. So ergibt sich über 541 Seiten eine durchweg spannende Geschichte, die jeden Krimifan ein paar glückliche Stunden bescheren sollte. (K. Reschke)
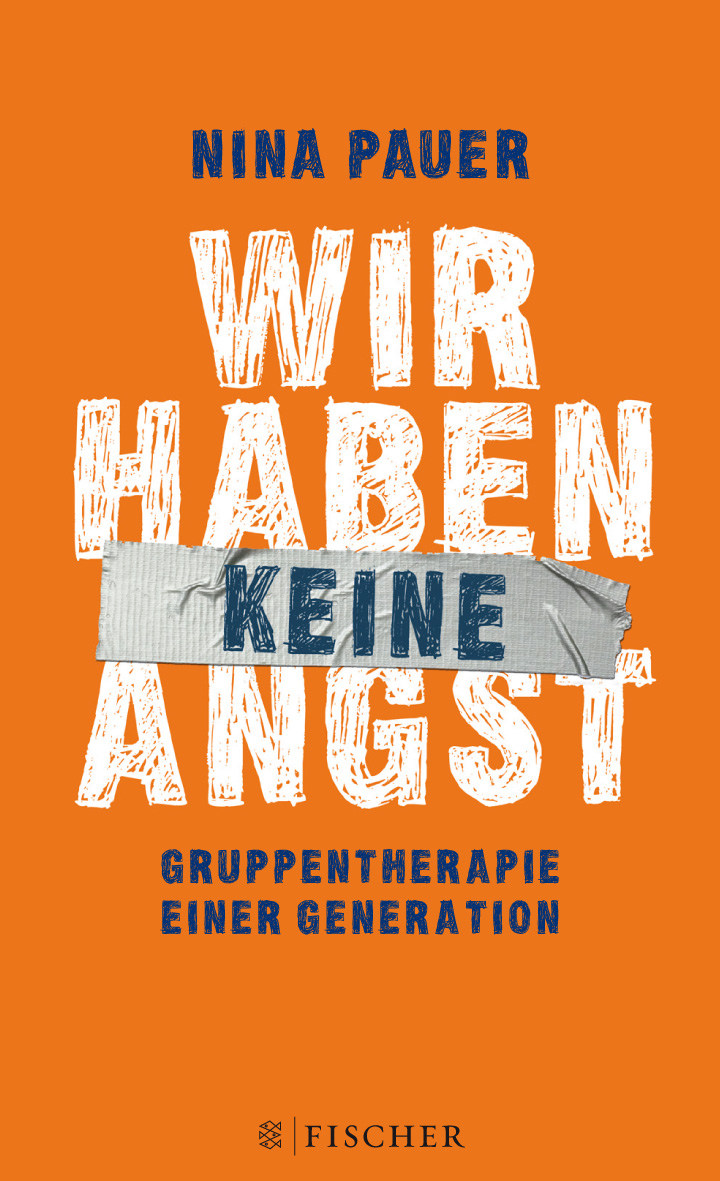 Alle Fans von Katja Kullmans Roman „Echtleben“ bekommen nun Nachschub aus der Feder Nina Pauers. Die langjährige ZEITmagazin-Redakteurin macht sich in ihrem Werk „Wir haben keine Angst“ daran, herauszufinden, warum heutzutage eigentlich kaum einer mehr imstande ist, eine Haltung zu gesellschaftlichen Missständen zu entwickeln. Laut Pauer sind wir diesbezüglich immer mehr von der tiefsitzenden Angst befallen, in unserem Leben falsche Entscheidungen zu treffen. Die immense Masse an Möglichkeiten raubt uns schlicht und ergreifend den Verstand, weil eigentlich niemand mehr dazu imstand ist, sich wirklich ein umfassendes Bild von etwas zu machen. Dementsprechend wird es Zeit, die Generation der Ängstlichen endlich mal aus ihren Löchern kriechen zu lassen und zu diesem Zweck kreiert sie kurzerhand zwei Akteure namens Anna und Bastian, die sich daran machen, diesem Umstand mit therapeutischer Hilfe entgegen zu treten. Anna Zum Beispiel wird von einer Schlafstörung geplagt, die sie nächtelang wach liegen lässt. Ständig hat sie Zweifel daran, ob sie ihren Job eigentlich gut genug macht. Wobei es bemerkenswert ist, dass sich die eigene Identität hier vor allem durch äußere Zuschreibung zu generieren scheint. Haben wir wirklich verlernt, uns auf unsere eigene Intuition zu verlassen? Und wo zum Teufel ist das Selbstbewusstsein geblieben, welches Generationen vor uns dazu brachte, die komplette Gesellschaft umzukrempeln? Ist es wirklich so schlimm aus der Reihe zu treten und alternative Wege einzuschlagen? Die Protagonisten dieses Buches scheinen im gleichen Maße Profiteure und Opfer ihrer Möglichkeiten zu sein. Dabei sollten sie vielleicht einfach auf „Stopp“ drücken, sich die Welt anschauen und sie dann nach ihrem Willen neu zusammensetzen. Um es mit den Worten der Fantastischen Vier auszudrücken: „Du bist nicht Opfer sondern Schöpfer deiner Welt, also schlag ich vor, du machst sie wie sie dir gefällt“. „Wir haben keine Angst“ macht den alltäglichen Wahnsinn greifbar, welchem sich zahlreiche Menschen dank zunehmender Reizüberflutung ausgeliefert fühlen. In diesem Zusammenhang scheint mir eine „Gruppentherapie einer Generation“ wirklich nötig zu sein. Oder vielleicht reicht es auch schon, mal wieder beim „Tante Emma Laden“ um die Ecke vorbeizuschauen, statt sich in monströsen Einkaufscentern herumzutreiben.
Alle Fans von Katja Kullmans Roman „Echtleben“ bekommen nun Nachschub aus der Feder Nina Pauers. Die langjährige ZEITmagazin-Redakteurin macht sich in ihrem Werk „Wir haben keine Angst“ daran, herauszufinden, warum heutzutage eigentlich kaum einer mehr imstande ist, eine Haltung zu gesellschaftlichen Missständen zu entwickeln. Laut Pauer sind wir diesbezüglich immer mehr von der tiefsitzenden Angst befallen, in unserem Leben falsche Entscheidungen zu treffen. Die immense Masse an Möglichkeiten raubt uns schlicht und ergreifend den Verstand, weil eigentlich niemand mehr dazu imstand ist, sich wirklich ein umfassendes Bild von etwas zu machen. Dementsprechend wird es Zeit, die Generation der Ängstlichen endlich mal aus ihren Löchern kriechen zu lassen und zu diesem Zweck kreiert sie kurzerhand zwei Akteure namens Anna und Bastian, die sich daran machen, diesem Umstand mit therapeutischer Hilfe entgegen zu treten. Anna Zum Beispiel wird von einer Schlafstörung geplagt, die sie nächtelang wach liegen lässt. Ständig hat sie Zweifel daran, ob sie ihren Job eigentlich gut genug macht. Wobei es bemerkenswert ist, dass sich die eigene Identität hier vor allem durch äußere Zuschreibung zu generieren scheint. Haben wir wirklich verlernt, uns auf unsere eigene Intuition zu verlassen? Und wo zum Teufel ist das Selbstbewusstsein geblieben, welches Generationen vor uns dazu brachte, die komplette Gesellschaft umzukrempeln? Ist es wirklich so schlimm aus der Reihe zu treten und alternative Wege einzuschlagen? Die Protagonisten dieses Buches scheinen im gleichen Maße Profiteure und Opfer ihrer Möglichkeiten zu sein. Dabei sollten sie vielleicht einfach auf „Stopp“ drücken, sich die Welt anschauen und sie dann nach ihrem Willen neu zusammensetzen. Um es mit den Worten der Fantastischen Vier auszudrücken: „Du bist nicht Opfer sondern Schöpfer deiner Welt, also schlag ich vor, du machst sie wie sie dir gefällt“. „Wir haben keine Angst“ macht den alltäglichen Wahnsinn greifbar, welchem sich zahlreiche Menschen dank zunehmender Reizüberflutung ausgeliefert fühlen. In diesem Zusammenhang scheint mir eine „Gruppentherapie einer Generation“ wirklich nötig zu sein. Oder vielleicht reicht es auch schon, mal wieder beim „Tante Emma Laden“ um die Ecke vorbeizuschauen, statt sich in monströsen Einkaufscentern herumzutreiben.
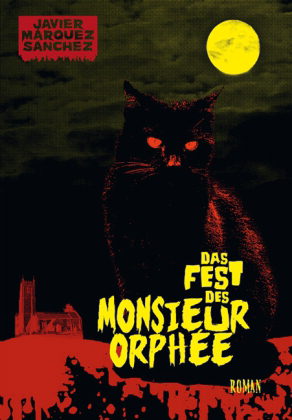 Ein grafisches Meisterstück ist dem „Walde + Graf“-Verlag derweil mal wieder beim neuen Roman von Javier Marquez Sanchez geglückt. Allein schon die verspielte Aufmachung des Buches „Das Fest des Monsieur Orphée“ ist ein Augenschmaus. Die Geschichte dreht sich um einen Schauspieler namens Peter Cushing (den Schauspieler gab es übrigens wirklich. Er hat einige Male für Verfilmungen von „Sherlock Holmes“ auf der Bühne gestanden), der sich bei seinen Vorbereitungen auf einen Frankenstein-Film mit einem 20er Jahre-Streifen auseinander setzen muss, der vom Belzebub höchstpersönlich gedreht worden sein soll – noch dazu soll der Film unschuldige Menschen dazu verleitet haben, ganz schreckliche Schandtaten zu begehen. So sollen unter anderem die Kinder einer kleinen Ortschaft nach Genuss des Streifens alle Erwachsenen des Dorfes umgebracht und noch dazu den Priester gekreuzigt haben. In diesem Zusammenhang kommen dann auch die beiden Agenten Andrew Carmichael und Harry Logan ins Spiel, die sich ebenfalls daran gemacht haben, das Unfassbare aufzuklären. Gemeinsam mit dem Schauspieler versuchen sie dem ganzen Spuck schließlich auf die Schliche zu kommen, wobei die Aufmachung in bester „Edgar Wallace“-Manier die Richtung bereits vorgibt. Überhaupt ist das Buch nur so gespickt mit Seitenhieben auf die Gruselkultur der 60er Jahre. Unabhängig davon lebt es aber vor allem von seiner spannenden Story, die sich kein Gespenstergeschichten-Fan entgehen lassen sollte. Womit wir dann auch schon wieder durch wären für heute. Also lasst es euch gut gehen. Wir „lesen“ uns.
Ein grafisches Meisterstück ist dem „Walde + Graf“-Verlag derweil mal wieder beim neuen Roman von Javier Marquez Sanchez geglückt. Allein schon die verspielte Aufmachung des Buches „Das Fest des Monsieur Orphée“ ist ein Augenschmaus. Die Geschichte dreht sich um einen Schauspieler namens Peter Cushing (den Schauspieler gab es übrigens wirklich. Er hat einige Male für Verfilmungen von „Sherlock Holmes“ auf der Bühne gestanden), der sich bei seinen Vorbereitungen auf einen Frankenstein-Film mit einem 20er Jahre-Streifen auseinander setzen muss, der vom Belzebub höchstpersönlich gedreht worden sein soll – noch dazu soll der Film unschuldige Menschen dazu verleitet haben, ganz schreckliche Schandtaten zu begehen. So sollen unter anderem die Kinder einer kleinen Ortschaft nach Genuss des Streifens alle Erwachsenen des Dorfes umgebracht und noch dazu den Priester gekreuzigt haben. In diesem Zusammenhang kommen dann auch die beiden Agenten Andrew Carmichael und Harry Logan ins Spiel, die sich ebenfalls daran gemacht haben, das Unfassbare aufzuklären. Gemeinsam mit dem Schauspieler versuchen sie dem ganzen Spuck schließlich auf die Schliche zu kommen, wobei die Aufmachung in bester „Edgar Wallace“-Manier die Richtung bereits vorgibt. Überhaupt ist das Buch nur so gespickt mit Seitenhieben auf die Gruselkultur der 60er Jahre. Unabhängig davon lebt es aber vor allem von seiner spannenden Story, die sich kein Gespenstergeschichten-Fan entgehen lassen sollte. Womit wir dann auch schon wieder durch wären für heute. Also lasst es euch gut gehen. Wir „lesen“ uns.
UND WAS NUN?