Darauf hat die Welt gewartet. Peter Doherty lässt die Hosen runter. Musikalisch wohlgemerkt. Mit seinem ersten Soloalbum „Grace/Wastelands“ wandelt er im Schatten seiner großen Tage mit den Libertines. Es schnappt sich einfach den lieben Graham Coxon von Blur und legt ein kleines Meisterwerk vor. Es ist schlicht bewundernswert, wie er da immer noch ein Stück mehr Emotion aus den Songs presst. Wie er scheinbar beiläufig seine Stimme über die Musik erhebt und klingt, als würde er nebenher noch den Rausch von letzter Nacht auskurieren. Mit diesem Album wird erneut deutlich, dass man es hier mit einem der bemerkenswertesten Künstler der Neuzeit zu tun hat. Wer so nonchalant einen Hit nach dem anderen intoniert, als käme er mal eben ins Studio getorkelt und würde frei Schnauze drauf los dichten, wie Poetry Slam-Teilnehmer. Der könnte auch einen Farbklecks auf eine weiße Wand schmettern und würde ein großes Kunstwerk erschaffen. Mit seinem Soloalbum knüpft Mr. Doherty letztlich an seine goldenen Zeiten mit den Libertines an. Auch wenn ihm leider Carl Barat als musikalischer Gegenpart fehlt. Dieses Album werden die Menschen trotzdem lieb gewinnen. Gerade weil sich der Künstler über die Karikatur seiner selbst erhebt. Raus aus den Medien. Rein ins Herz.
Vor ein paar Jahren spielte derweil im Würzburger Jugendkulturhaus eine Combo aus London, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Zu Unrecht muss man sagen: trafen sie mit ihrem sixties-influenced Indie-Pop eigentlich genau den Geschmack der Massen, die sich zu Mando Diao und den Hives den Arsch abwackelten und laut im Chor grölten. Vielleicht war der Erstling aber auch eine Spur zu brav, oder wie soll man sagen: zu subtil für die Massen. Die Produktion geriet dermaßen retro, dass man sich zeitweise wirklich fragte, ob man es hier nicht mit einer antiquierten, aber dennoch charmanten Aufnahme aus den 60ern zu tun hatte. Jetzt also sind The Bishops wieder da. „For Now“ zumindest. „And forever“? Das muss sich erst noch zeigen. Allerdings müsste es wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn das Ding hier kein Hit wird. Das Album ist kurz gesagt: eine Ansammlung von 14 Hitsingles. The Kinks meets The Strokes oder so ähnlich. Und diesmal so zeitgemäß aufpoliert, dass das Ganze direkt nach den Jungs von Franz Ferdinand aufs Publikum abgefeuert werden kann. Wenn man dazu noch bedenkt, dass die Bishops eine famose Liveband sind. Dass sie die Zuschauer mit ihrer Performance auf einen Malerei-Workshop mitnehmen und jedem einen fetten Smiley ins Gesicht zeichnen. Und bevor jetzt wieder die alten Klagen kommen: Sonnenschein-Indie mit dermaßen viel Popappeal hätte ja sowieso keine allzu lange Halbwertszeit. Dieses Album ist einfach nicht totzukriegen. Da sitzt jeder Ton. Und man fragt sich zwischenzeitlich, wie das eigentlich möglich ist: dass die Musikwelt diese Band bisher übersehen konnte. Zeit für ein bisschen Furore. Die Bishops haben den passenden Lichtkegel zum Nachtdurchtanzen und wirken wie der verliebte Blick des Himmels, wenn nach durchfeierter Nacht die ersten Sonnenstrahlen durchs Haar streichen. Da möchte man sich anschließend fast ein Shirt mit „I Wanna Be A Hippie“-Schriftzug überstreifen. Man sollte nur aufpassen, dass man dafür nicht gesteinigt wird. Alles in allem: Die perfekte Frühlingsplatte für Freunde des gehobenen Popzitats.
Dass Kissogram derweil mit den Jungs von Franz Ferdinand durch Europa reisen, kann nicht weiter verwundern. Schließlich klingen die schon seit geraumer Zeit wie eine um Elektro- und Balkan-Anleihen angereicherte Version der schottischen Chartstürmer. Ihr drittes Album geht dann auch gleich mal los, als wollten sie den Club schon vor der Hauptband auseinander nehmen. „Ah Come On, Boys, We´re Gonna Ratatata“ und ab dafür. So muss ein Album losgehen. Und ich bin bereit. Der gleichnamige Titelsong wird gleich noch hinterher geschoben und schon gerät die Meute ordentlich ins Schwitzen. Nur leider kommen die Jungs auf der zweiten Hälfte von „Rubber And Meat“ immer wieder vom Weg ab und finden auch nicht richtig in die Spur zurück. Am schlimmsten gerät das nervtötende „Lucy“, ein ballernder „I Was Made For Loving You“-Abklatsch, der etwas zu offensichtlich in Richtung Tanzfläche schielt. Dann vielleicht doch lieber ein solch sphärischer Exzess, wie „Don´t Look At Me Like This“, das den verdutzten Hörer in die kalte Nacht hinaus stößt. Alles in allem ein Album, das anmutet, wie eine Bergtour. Bisweilen anstrengend wandeln die zwölf Tracks immer wieder am Rande des Abgrunds und wirken eben deshalb so himmelhoch jauchzend und euphorisierend.
Danach gönnen wir uns erstmal eine kleine Ruhepause mit dem Weichzeichner-Pop von Maximilian Hecker. In Asien ist der ja schon schnurstracks durch die Decke gegangen und auch hierzulande sollte es jetzt klappen. Seine Wunderwaffe hört auf den Namen „One Day“ und wirkt wie ein wunderbarer Popentwurf für kuschelige Wintertage. Man möchte glatt die Weihnachtsbeleuchtung noch mal aus dem Schrank kramen und sich unter den Tannenbaum pflanzen. So sehnsuchtsvoll, wie „Wind Down“ hat einen schon lange keine Pop-Ballade mehr abgeholt. All das wirkt so hoffnungslos hingebungsvoll. Man möchte sich einfach nur vom Sound das Gemüt massieren lassen und auf einen großen Dampfer Richtung Paradies schippern. War der Vorgänger bisweilen etwas erschöpfend, schafft es Hecker mit diesem Album seine Musik auf den Punkt zu bringen. Dem Überfluss wird abgeschworen, stattdessen beschränken sich seine elf Songs auf das Wesentliche. Alles in allem die bisher beste Platte des Berliners. Seine Musik scheint der Schatten einer einzig wahren Liebe zu sein: zu den Momenten, in denen die Rädchen im System still stehen, die Zeit ins Stocken gerät und die Gefühle aus einem herauspreschen, wie Erbrochenes. „One Day“ macht all das greifbar, mit Stücken, die fast schon verstörend wirken vor lauter Offenheit. Da hört man nur allzu gerne genauer hin. Auch wenn es weh tut.
Ein literarisch angehauchtes Werk fabrizieren anschließend die Enablers. Das Trio aus San Francisco versucht sich auf „Tundra“ an einer musikalisch untermalten Spoken Word Performance, die sich eher schmeichelnd an einen drückt, als mit großer Geste und Augenzwinkern auf die lauten Lacher abzuzielen. Das Ganze ist mehr Poesie als Kampfansage, wie sie uns Henry Rollins immer wieder charmant und wortwitzig verkauft. Hin und wieder wandeln die Songs auch in Richtung herkömmliche Songstrukturen. In dem großartigen „The Destruction Most Of All“ schälen sich sogar Melodiebögen in Form von Gesang aus dem Background. Das Bemerkenswerteste aber ist: dieses Werk wird auf 1200 Stück limitiert in einer Holzbox auf den Markt kommen. Mit Stickern und anderem Schnickschnack. Da gucken die einschlägigen Downloadportale ganz schön blöd aus der Wäsche.
Wir machen es uns währenddessen auf einen kleinen Umtrunk bei Dirk Darmstaedter gemütlich. Der erzählt auf „Life Is No Movie“ kleine Geschichten aus dem Leben. Popmusik mit Indiemaske und allerhand Regentropfen im Gesicht. Soll heißen: Tränenreicher Radiopop der Sorte von der man sich nur zu gerne an der Nase herumführen lässt. Die Musik verkommt nicht zum Klischee. Klingt hin und wieder wie ein verkratztes Update von Matchbox 20. Und erzeugt gute Laune an Tagen, wenn sich die Sonne langsam ihren Weg aus den morgendlichen Nebelschwaden schält. Am Ende funkelt der Asphalt dann ein klein wenig heller als zuvor. So als wollte die Musik rufen: breite deine Arme aus und fang an abzuheben. Da liegt eine ganze Welt vor dir, also raus aus dem Alltag. Verbummel mal den Tag. Lass dich einfach treiben. Dirk Darmstaedter hat ein sehr konventionelles Album geschrieben, dessen größter Trumpf es ist, dass die Songs dir eine gewisse Leichtigkeit unterjubeln. „Life Is No Movie“ ist Zuckerwatte für den Tag. Klebrig, bunt und lecker.
In eine ähnliche Kerbe schlägt das neue Album von Garda. Sanfte Klänge a la Damien Rice und Conor Oberst umschmeicheln den Hörer auf „Die, Technique, Die!“. Im ersten Moment ist man wie erschlagen von der emotionalen Wucht, die dieses Scheibe ausstrahlt. Man möchte sich irgendwo festklammern, um nicht den Halt zu verlieren. Zumindest würde man nicht sonderlich hart fallen. Denn die Musik würde einen in Watte packen mit all ihrer Lieblichkeit. Die Songs schlittern immer wieder knapp an einem gehaucht, verzweifelten Moment vorbei. So, als wüssten Kai Lehmann (Gitarre, Gesang) und Ronny Wunderland (Schlagzeug) selbst noch nicht so genau, wo die Reise hin geht. Dabei ist es am Ende doch gerade dieser unberechenbare Moment, der das Album zu einer lohnenden Erfahrung für den geneigten Herbstmelancholiker macht.
Ebenso versiert in Herzensangelegenheiten präsentieren sich hinterher die Jungs von Bergen. Deutschsprachige Melancholie verliert sich ja nur zu gerne in plakativen Momenten. „Gegenteil von Stadt“ wiederum ist ein Album, das äußerst charmant zwischen den Seilenden Erdmöbel und Element Of Crime balanciert. Abgestürzt wird höchstens noch auf textlicher Ebene. Und da sieht man der Band nur zu gerne beim Fallen zu, weil sich so ein romantisches Gefühl einschleicht. „Gegenteil von Stadt“ ist ein sonderbares Album, das dennoch eine Herzenswärme ausstrahlt, wie man sie in deutschsprachigen Gefilden nur selten erlebt. Alles in allem ein echter Geheimtipp für Freunde von Schlagerklängen, die Schlager im Grunde genommen aus tiefstem Herzen verabscheuen.
Wer sich derweil schon nach neuem Stoff der Beastie Boys sehnt, der sollte mal Xrabit + DMG$ anchecken. Die fabrizieren unter dem Motto „Hello World“ einen durchweg genialen Elektro-Rap-Entwurf, der sich versiert auf die Tanzfläche schlängelt. Mit jedem Durchlauf schließt man Tracks, wie „Ferris Bueller“ (erinnert sich eigentlich noch jemand an den famosen Streifen „Ferris macht blau“? Unbedingt mal reinziehen und dann Schule schwänzen) und „Follow The Leader“ tiefer ins Herz. Plötzlich steht man am Fenster und brüllt der Welt die Punchlines dieser Partyrakete entgegen. Untermalt von den schicken Beats von Produzent Xrabit schrauben Trak Bully und Coool Dundee ihre vertrackten Reime in die Gehirnwindungen des Hörers und schubsen ihn auf die Tanzfläche. So eine Partyplatte habe ich lange nicht mehr gehört. Das toppen derzeit höchstens noch die…
Puppetmastaz. Mit Puppenbonus rappt es sich schließlich gleich doppelt so gut. Dabei sind die eigentlich voll fies. Aber eben auch versierte Reimer. Und live sowieso unübertroffen. Wenn sie Bilder aus Star Wars mit Szenen aus der Muppet-Show verknüpfen, wirkt das wie ein Zitatgewitter, dem man sich nur schwer verweigern kann. Das ist ganz großes Kino. Wundert mich ehrlich gesagt, dass die noch nicht in einer Liga mit Deichkind spielen. Dafür ist die Musik aber vielleicht eine Spur zu abgefahren. Denn auf „The Takeover“ muss man schon genauer hinhören, um sich zurecht zu finden. Da wird nicht nur die Partykeule raus geholt. Stattdessen eröffnet sich ein alternatives Universum, aus dem es kein Entrinnen gibt. Über 23 Tracks schrauben die Puppen am Grinsegesicht des Hörers. Verkehren es allerdings auch mal zur Fratze. Und schreien immer wieder laut „Bring Your Puppet – Join The Movement!“. Man ist geneigt ihnen auf der Stelle zu folgen. Jedenfalls karren sie dermaßen viele Hits an, dass sich selbst Outkast warm anziehen sollten, um das noch zu übertreffen. Insgesamt ein krönender Abschluss eines tollen Plattenregens. Also lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Zuckerbeat.
// alexander nickel-hopfengart
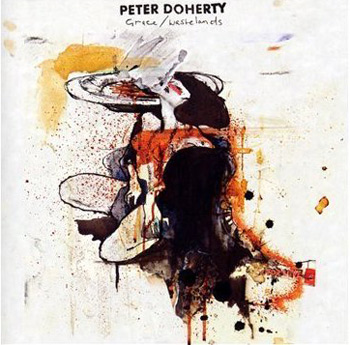 Darauf hat die Welt gewartet.
Darauf hat die Welt gewartet.  Vor ein paar Jahren spielte derweil im Würzburger Jugendkulturhaus eine Combo aus London, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Zu Unrecht muss man sagen: trafen sie mit ihrem sixties-influenced Indie-Pop eigentlich genau den Geschmack der Massen, die sich zu Mando Diao und den Hives den Arsch abwackelten und laut im Chor grölten. Vielleicht war der Erstling aber auch eine Spur zu brav, oder wie soll man sagen: zu subtil für die Massen. Die Produktion geriet dermaßen retro, dass man sich zeitweise wirklich fragte, ob man es hier nicht mit einer antiquierten, aber dennoch charmanten Aufnahme aus den 60ern zu tun hatte. Jetzt also sind
Vor ein paar Jahren spielte derweil im Würzburger Jugendkulturhaus eine Combo aus London, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Zu Unrecht muss man sagen: trafen sie mit ihrem sixties-influenced Indie-Pop eigentlich genau den Geschmack der Massen, die sich zu Mando Diao und den Hives den Arsch abwackelten und laut im Chor grölten. Vielleicht war der Erstling aber auch eine Spur zu brav, oder wie soll man sagen: zu subtil für die Massen. Die Produktion geriet dermaßen retro, dass man sich zeitweise wirklich fragte, ob man es hier nicht mit einer antiquierten, aber dennoch charmanten Aufnahme aus den 60ern zu tun hatte. Jetzt also sind  Dass
Dass  Danach gönnen wir uns erstmal eine kleine Ruhepause mit dem Weichzeichner-Pop von
Danach gönnen wir uns erstmal eine kleine Ruhepause mit dem Weichzeichner-Pop von 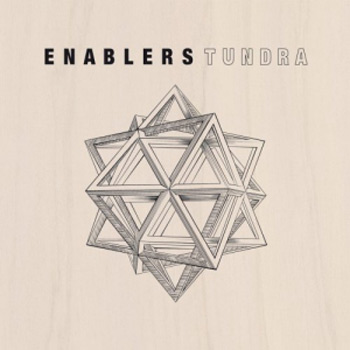 Ein literarisch angehauchtes Werk fabrizieren anschließend die
Ein literarisch angehauchtes Werk fabrizieren anschließend die  Wir machen es uns währenddessen auf einen kleinen Umtrunk bei
Wir machen es uns währenddessen auf einen kleinen Umtrunk bei  In eine ähnliche Kerbe schlägt das neue Album von Garda. Sanfte Klänge a la Damien Rice und Conor Oberst umschmeicheln den Hörer auf „Die, Technique, Die!“. Im ersten Moment ist man wie erschlagen von der emotionalen Wucht, die dieses Scheibe ausstrahlt. Man möchte sich irgendwo festklammern, um nicht den Halt zu verlieren. Zumindest würde man nicht sonderlich hart fallen. Denn die Musik würde einen in Watte packen mit all ihrer Lieblichkeit. Die Songs schlittern immer wieder knapp an einem gehaucht, verzweifelten Moment vorbei. So, als wüssten Kai Lehmann (Gitarre, Gesang) und Ronny Wunderland (Schlagzeug) selbst noch nicht so genau, wo die Reise hin geht. Dabei ist es am Ende doch gerade dieser unberechenbare Moment, der das Album zu einer lohnenden Erfahrung für den geneigten Herbstmelancholiker macht.
In eine ähnliche Kerbe schlägt das neue Album von Garda. Sanfte Klänge a la Damien Rice und Conor Oberst umschmeicheln den Hörer auf „Die, Technique, Die!“. Im ersten Moment ist man wie erschlagen von der emotionalen Wucht, die dieses Scheibe ausstrahlt. Man möchte sich irgendwo festklammern, um nicht den Halt zu verlieren. Zumindest würde man nicht sonderlich hart fallen. Denn die Musik würde einen in Watte packen mit all ihrer Lieblichkeit. Die Songs schlittern immer wieder knapp an einem gehaucht, verzweifelten Moment vorbei. So, als wüssten Kai Lehmann (Gitarre, Gesang) und Ronny Wunderland (Schlagzeug) selbst noch nicht so genau, wo die Reise hin geht. Dabei ist es am Ende doch gerade dieser unberechenbare Moment, der das Album zu einer lohnenden Erfahrung für den geneigten Herbstmelancholiker macht.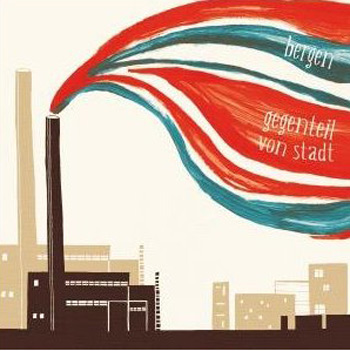 Ebenso versiert in Herzensangelegenheiten präsentieren sich hinterher die Jungs von Bergen. Deutschsprachige Melancholie verliert sich ja nur zu gerne in plakativen Momenten. „Gegenteil von Stadt“ wiederum ist ein Album, das äußerst charmant zwischen den Seilenden Erdmöbel und Element Of Crime balanciert. Abgestürzt wird höchstens noch auf textlicher Ebene. Und da sieht man der Band nur zu gerne beim Fallen zu, weil sich so ein romantisches Gefühl einschleicht. „Gegenteil von Stadt“ ist ein sonderbares Album, das dennoch eine Herzenswärme ausstrahlt, wie man sie in deutschsprachigen Gefilden nur selten erlebt. Alles in allem ein echter Geheimtipp für Freunde von Schlagerklängen, die Schlager im Grunde genommen aus tiefstem Herzen verabscheuen.
Ebenso versiert in Herzensangelegenheiten präsentieren sich hinterher die Jungs von Bergen. Deutschsprachige Melancholie verliert sich ja nur zu gerne in plakativen Momenten. „Gegenteil von Stadt“ wiederum ist ein Album, das äußerst charmant zwischen den Seilenden Erdmöbel und Element Of Crime balanciert. Abgestürzt wird höchstens noch auf textlicher Ebene. Und da sieht man der Band nur zu gerne beim Fallen zu, weil sich so ein romantisches Gefühl einschleicht. „Gegenteil von Stadt“ ist ein sonderbares Album, das dennoch eine Herzenswärme ausstrahlt, wie man sie in deutschsprachigen Gefilden nur selten erlebt. Alles in allem ein echter Geheimtipp für Freunde von Schlagerklängen, die Schlager im Grunde genommen aus tiefstem Herzen verabscheuen.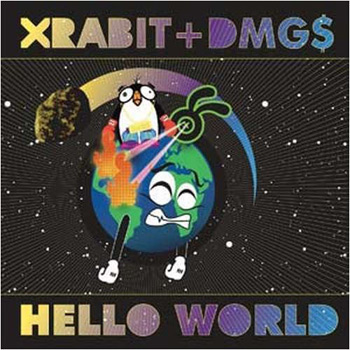 Wer sich derweil schon nach neuem Stoff der Beastie Boys sehnt, der sollte mal
Wer sich derweil schon nach neuem Stoff der Beastie Boys sehnt, der sollte mal  Puppetmastaz
Puppetmastaz
UND WAS NUN?