mit dem Werken „Fischtage“ und „Herzgrube“.

// Zwei Romane, die beide in diesen Tagen erscheinen, könnten auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher wirken: Herzgrube von Andrew McMillan, das literarische Debüt eines gefeierten britischen Lyrikers, und Fischtage von Charlotte Brandi, der Erstling einer Musikerin, die hier mit wildem Stilwillen und radikalem Ton in die deutschsprachige Literatur sticht. Doch beide Werke verbindet etwas sehr Entscheidendes: ein tiefes Gespür für Verletzlichkeit, Zugehörigkeit und die Frage, wie wir in einer Welt überleben, in der es keine einfachen Antworten mehr gibt. Herzgrube ist eine jener Geschichten, die nachhallen – leise, aber durchdringend. Andrew McMillan, dessen Gedichte schon immer zwischen Körperlichkeit und Zartheit, Härte und Sensibilität pendelten, überträgt dieses Spannungsfeld mühelos in seinen ersten Roman. Die Figuren – allen voran Simon, der zwischen Callcenter, Dragshows und gelegentlicher Sexarbeit ein Leben lebt, das gleichzeitig kraftvoll und fragil wirkt – atmen und fühlen auf jeder Seite.
McMillans Sprache, wunderbar ins Deutsche gebracht von Robin Detje, ist poetisch, ohne je zu blumig zu sein. Es gibt Sätze, bei denen ich kurz das Buch weglegen musste, um ihnen nachzuspüren. Was mich besonders berührt hat, war die Beziehung zwischen Simon und seinem Vater Alex. Sie ist nicht versöhnt, nicht heil – und gerade deshalb so real. Die Geschichte der ehemaligen Grube, die die Stadt Barnsley wie ein dunkles Herz durchzieht, wird nicht nur als Kulisse genutzt, sondern wirkt wie eine zweite Erzählebene: Die Erde, aus der einst Leben gezogen wurde, hat ihre Bewohner verschluckt – und zurück bleibt eine Generation, die mit der Vergangenheit kämpft und sich in der Gegenwart neu erfinden muss. McMillan gelingt das Kunststück, queere Identität nicht als Fremdkörper in einer „harten“ Umgebung darzustellen, sondern als eine Form von Überleben, Widerstand und Schönheit. Das ist nicht laut, sondern tief und wahr. Dann Fischtage, ein ganz anderes, aber nicht minder beeindruckendes Erlebnis.
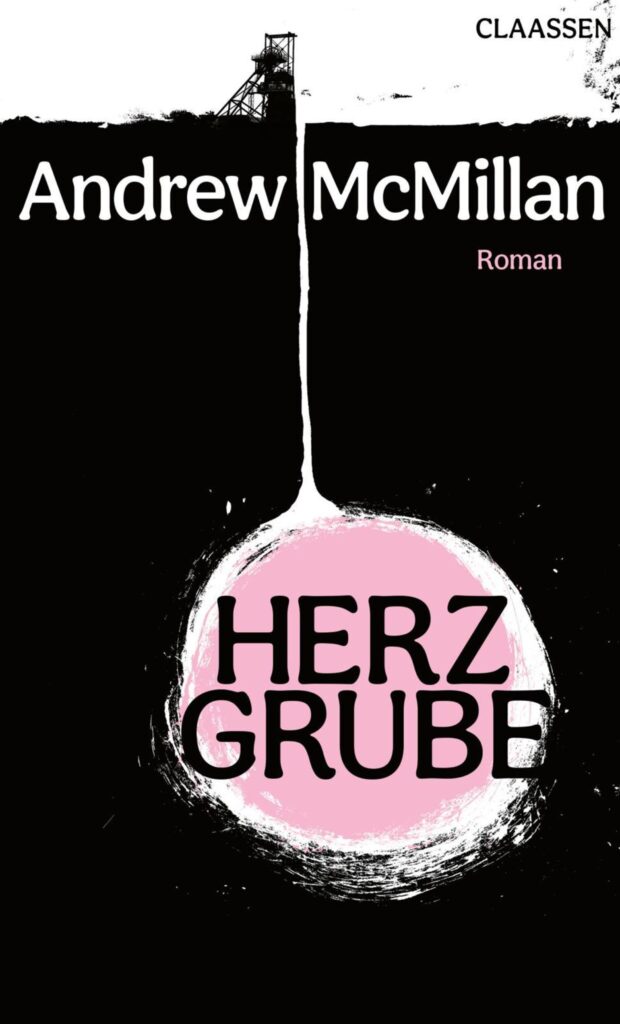
Charlotte Brandi erzählt aus der Sicht der sechzehnjährigen Ella – und ich war sofort bei ihr. Diese ungezähmte, widersprüchliche Ich-Erzählerin, die sich weigert, in irgendeine Form zu passen, trifft mit voller Wucht. Ihr Zorn, ihre Einsamkeit, ihr Hang zum Rückzug – all das ist glaubhaft, schmerzhaft und gleichzeitig poetisch aufgeladen. Dass sie sich ausgerechnet an einen singenden Plastikfisch klammert, wirkt zuerst wie ein skurriler Einfall, offenbart aber schnell eine tiefere Wahrheit: Manchmal ist das Absurde das Einzige, das uns noch hält. Brandi gelingt es, mit wilder Zärtlichkeit und klarem Ton eine Geschichte zu erzählen, die so voll ist von brüchiger Hoffnung, dass ich beim Lesen oft nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte. Und genau das macht diesen Roman so stark. Die Suche nach dem verschwundenen Bruder wird zur Reise in ein inneres Chaos – mit Aldi-Tüte und Herz in der Hand, mutig, trotzig, zart. Was diese beiden Bücher verbindet – bei aller Unterschiedlichkeit in Stil, Setting und Perspektive – ist ihre Fähigkeit, das Menschliche im Unscheinbaren zu finden. Beide Geschichten spielen am Rand der Gesellschaft, im Schatten von Verlust und Nicht-Zugehörigkeit. Doch sie verweigern sich dem Pathos und dem Pessimismus. Stattdessen geht es in Herzgrube wie in Fischtage um die Kraft, trotz allem weiterzumachen. Um Identität, die nicht geschenkt wird, sondern erkämpft werden muss. Um das, was passiert, wenn Menschen sich auf die Suche machen – nach anderen und nach sich selbst. Wenn ich an die Lektüre beider Romane zurückdenke, bleibt bei mir ein Gefühl von tiefem Respekt. Respekt vor dem Mut, so ehrlich und verletzlich zu schreiben. Respekt vor Figuren, die nicht glatt und liebenswert sind, sondern widersprüchlich, wütend, einsam, mutig – wie wir alle. Wer bereit ist, sich auf diese zwei literarischen Reisen einzulassen, wird reich belohnt. Nicht mit einfachen Antworten, aber mit Erkenntnissen, die unter die Haut gehen.
UND WAS NUN?