mit dem Werk „Play“ von Johann Scheerer.
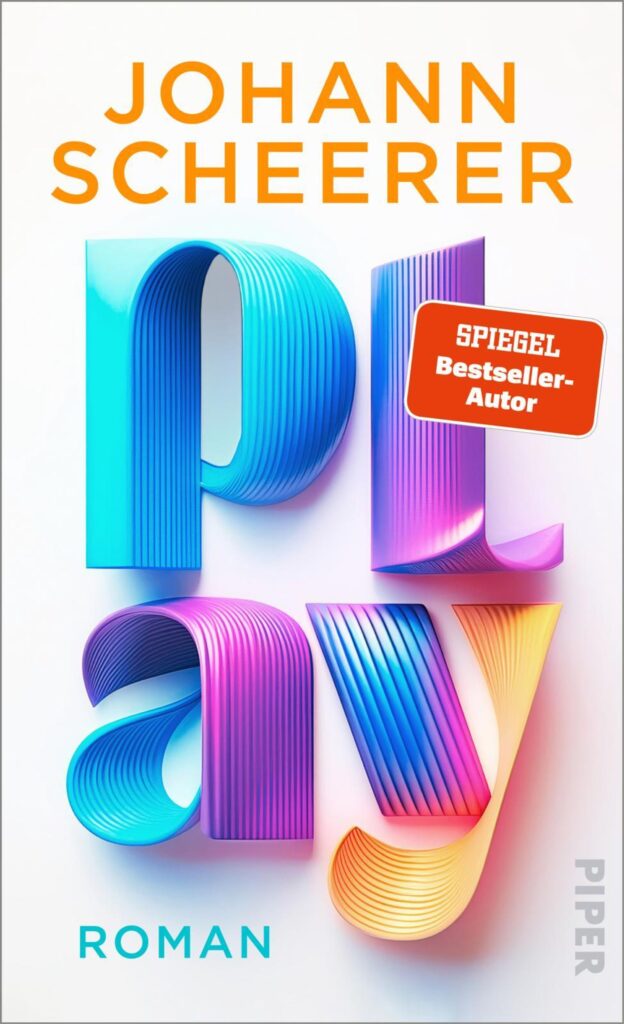
// Manchmal kommt ein Roman daher, der sich anfühlt wie ein Song, den man noch nie gehört hat und der einem dennoch sofort vertraut ist. So ging es mir mit Play von Johann Scheerer. Ein Buch, das mit seinem Titel allein schon eine doppelte Einladung ausspricht: zum Spielen – und zum Ernstnehmen dessen, was zwischen all den Spielarten des Lebens passiert. Der Roman liest sich wie ein Track, der zwischen leisen Loops und plötzlichen Noise-Attacken pendelt, zwischen Elternabend und Backstage, zwischen übermüdetem Frühstück mit Müsli und durchgeknalltem Soundcheck in einem finnischen Club um halb zwei nachts. Und genau das ist seine Stärke: Diese Gleichzeitigkeit von Chaos und Schönheit, von Erschöpfung und Euphorie. Im Mittelpunkt steht David, ein Mann, der auf dem Papier alles unter Kontrolle hat, in der Realität aber ständig kurz vor dem Umkippen steht. Als Musikmanager des kapriziösen, drogenumwölkten, unberechenbaren Superstars Ian White lebt er auf einem Pulverfass – privat wie beruflich. Seine Lösung: die Kinder mit auf Tour nehmen. Was auf den ersten Blick absurd klingt, wird in Scheerers Roman zu einem beinahe logischen Schritt.
Denn was unterscheidet letztlich den exzentrischen Rockstar vom trotzig brüllenden Dreijährigen, wenn beide absolute Aufmerksamkeit, emotionale Fürsorge und grenzenlose Geduld einfordern? Diese Parallele zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman und ist auf eine sehr menschliche, manchmal traurige, oft urkomische Weise absolut überzeugend. Was Scheerer hier gelingt, ist bemerkenswert. Er schreibt mit einem Tonfall, der etwas völlig Eigenes hat: zurückhaltend und gleichzeitig durchdrungen von kluger Beobachtung, liebevoll im Detail und dabei stets mit einem leicht müden Grinsen im Hintergrund. Kein Zynismus, kein Pathos, sondern eine Art leiser Trotz gegen die Unvereinbarkeit von Kunst und Care-Arbeit. David taumelt, stolpert, witzelt sich durch die Stationen seiner Tage, schiebt Kinderwagen und hängt sich gleichzeitig das Alltagsdrama eines krisengeschüttelten Musikers ans Bein. Dass dabei irgendwann Realität und Fiktion, Verantwortung und Wahnsinn verschwimmen, ist unausweichlich – und genau darin liegt der emotionale Kern des Romans. Scheerer lässt uns immer wieder tief hinter die Kulissen blicken, nicht nur ins Musikbusiness mit all seinen Egos und Exzessen, sondern auch in die Zerbrechlichkeit männlicher Identität zwischen Anspruch und Überforderung. David ist kein Held, kein Opfer, sondern einfach ein Typ, der versucht, all dem irgendwie gerecht zu werden – seinen Kindern, seinem Künstler, sich selbst. Dass er daran fast zerbricht, macht ihn nur glaubwürdiger. Und dass er sich trotzdem nicht selbst bemitleidet, sondern das Absurde des Alltags mit einem fast stoischen Humor durchzieht, macht ihn zu einem der interessantesten Väterfiguren, die ich seit langem in der deutschsprachigen Literatur gelesen habe. Natürlich spielt auch Scheerers eigene Biografie in dieses Buch hinein – seine Musikproduzenten-Karriere, sein Umgang mit exzentrischen Künstlern, seine Beobachtungsgabe für Zwischenräume. Aber „Play“ ist mehr als ein autobiografisch grundierter Roman. Es ist ein ehrlicher, kluger und manchmal wilder Text über die Risse zwischen Kunst und Leben, über das Jonglieren mit zu vielen Bällen und die Frage, ob man dabei trotzdem eine Melodie spielen kann, die nicht auseinanderfällt. Man liest das Buch, lacht, zuckt zusammen, erkennt sich wieder – und möchte am Ende am liebsten mit David auf irgendeiner schäbigen Hotelzimmercouch sitzen, das Baby im Arm und eine Playlist voller schöner, schiefer Songs im Ohr. Vielleicht ist das die größte Leistung dieses Romans: Er erzählt nicht nur davon, wie es ist, wenn alles gleichzeitig passiert – er lässt es einen fühlen. Und irgendwie macht das Mut. Weil man am Ende merkt: Vielleicht ist es genau das, was „Leben“ bedeutet. Nicht das perfekte Timing, sondern der Mut, überhaupt zu spielen. Trotz allem.
UND WAS NUN?