mit dem für den Deutschen Buchpreis nominierten Werk „Und Federn überall“ von Nava Ebrahimi.
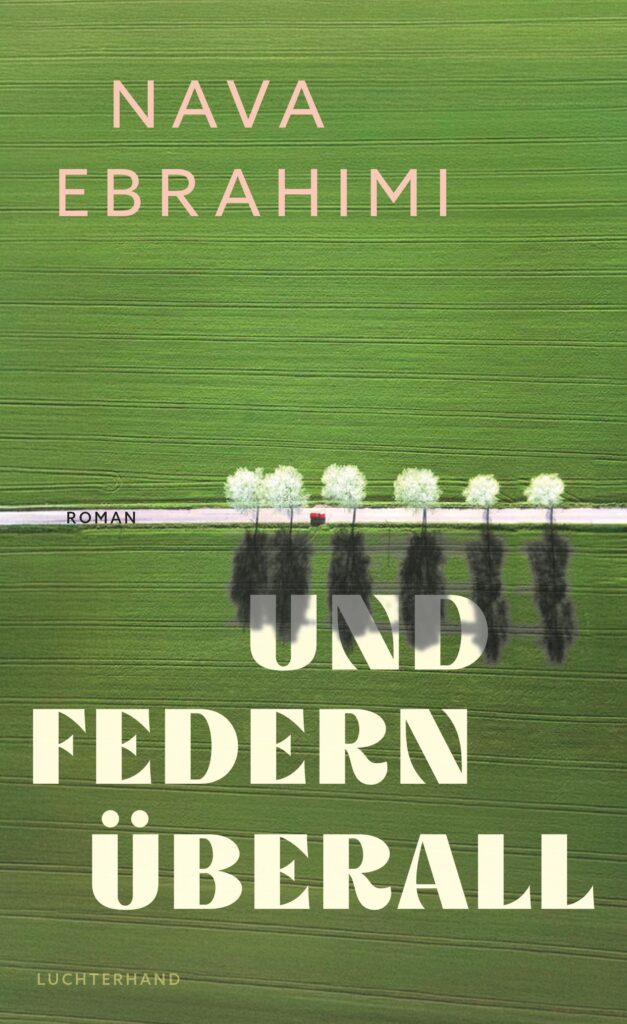
// Als ich das auf der Longlist des diesjährigen Buchpreises stehende Werk Und Federn überall von Nava Ebrahimi aufschlug, hatte ich sofort das Gefühl, dass hier nicht einfach eine Geschichte erzählt wird, sondern dass sich eine ganze Welt auftut – eine Welt, die auf den ersten Blick unscheinbar wirkt und doch voller Risse, Sehnsüchte und unausgesprochener Wahrheiten steckt. Die Kleinstadt Lasseren im Emsland ist ein Ort, den man leicht übersehen könnte: flaches Land, Nebel, ein Schlachthof als größter Arbeitgeber. Aber genau in dieser Provinz zeigt Ebrahimi, wie intensiv und universell das Leben sein kann. Die Erzählung entfaltet sich über einen einzigen Tag, und trotzdem wirkt es, als würde man Zeuge ganzer Biografien. Sonia, die alleinerziehende Mutter, hat mir besonders nahegestanden – ihre stille Hoffnung, irgendwo einen Platz zu finden, an dem sie mehr ist als eine Arbeitskraft am Fließband, ist so nachvollziehbar, dass ich beim Lesen mehrfach schlucken musste.
Ganz anders Anna, die junge Ingenieurin, die beweisen muss, dass ihre Automatisierung im Schlachthof funktioniert. Sie steht für eine Generation, die inmitten von Technologie und Leistungsdruck versucht, nicht unterzugehen. Dann dieser tragikomische Merkhausen – ein verlassener Mann, der zwischen Prozessoptimierung und polnischen Dating-Abenteuern schwankt. Und mittendrin Nassim, der geflüchtete Afghane, der glaubt, seine Gedichte könnten deutsche Bürokraten erweichen. In seiner Zerrissenheit, in seiner Sehnsucht nach Anerkennung und Zugehörigkeit, liegt etwas ungeheuer Zartes. Die Affäre mit der älteren Justyna wirkt gleichzeitig schutzlos und trotzig – als wolle er sich mit aller Kraft ins Leben hineinschreiben. Besonders eindrücklich ist für mich Roshi gewesen, die Autorin aus Köln, die Nassims Texte übersetzt. Sie ist wie eine Spiegelung Ebrahimis selbst – eine Vermittlerin zwischen Sprachen, zwischen Kulturen, zwischen Welten. In ihren Augen bündeln sich die Fragen, die das ganze Buch durchziehen: Wie erzählen wir unser Leben? Wer darf es übersetzen, deuten, weitergeben? Was mich beim Lesen regelrecht umgehauen hat, war, wie Ebrahimi aus kleinen, fast unspektakulären Momenten Funken schlägt. Da ist die Szene mit dem kaputten Blindenstock, die eigentlich eine Randepisode sein könnte – und doch plötzlich eine ganze Stadt aufrüttelt. Plötzlich bekommt Nassim eine Stimme im Lokalradio, plötzlich hören die Menschen hin, und plötzlich sind sie gezwungen, über sich selbst nachzudenken. Genau darin liegt die Stärke dieses Romans: Er zeigt, wie das scheinbar Unbedeutende zu einer Art Wendepunkt werden kann. Sprachlich ist der Text leichtfüßig und zugleich präzise. Ebrahimi schreibt ohne Pathos, aber voller Empathie. Sie gibt jeder Figur eine eigene Farbe, einen eigenen Tonfall, und wenn man zwischen den Kapiteln wechselt, fühlt es sich an, als würde man von Zimmer zu Zimmer in einem Haus gehen, in dem alle auf ihre Weise einsam sind – und doch miteinander verbunden. Ich habe beim Lesen immer wieder das Gefühl gehabt, dass dieser Roman eine große Frage stellt: Was heißt es, menschlich zu bleiben, wenn die Umstände härter werden, wenn man ständig zu funktionieren hat, wenn das Leben einen in Schablonen drückt? Die Antwort gibt er nicht in Form von großen Reden, sondern durch die kleinen Gesten seiner Figuren: Sonias stilles Durchhalten, Nassims Glaube an die Kraft der Poesie, Annas Versuch, sich als Frau in einer Männerwelt zu behaupten. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass Ebrahimi nicht nur die Geschichte von sechs Menschen erzählt, sondern auch das Porträt einer Gesellschaft, die zwischen Stillstand und Aufbruch schwankt. Und Federn überall ist ein leiser, aber eindringlicher Roman, der zeigt, dass selbst in den unscheinbarsten Orten, an den Rändern, wo man nicht hinzuschauen meint, die großen Fragen unseres Zusammenlebens verhandelt werden.
UND WAS NUN?