mit dem für den Deutschen Buchpreis nominierten Werk „Die Ausweichschule“ von Kaleb Erdmann.
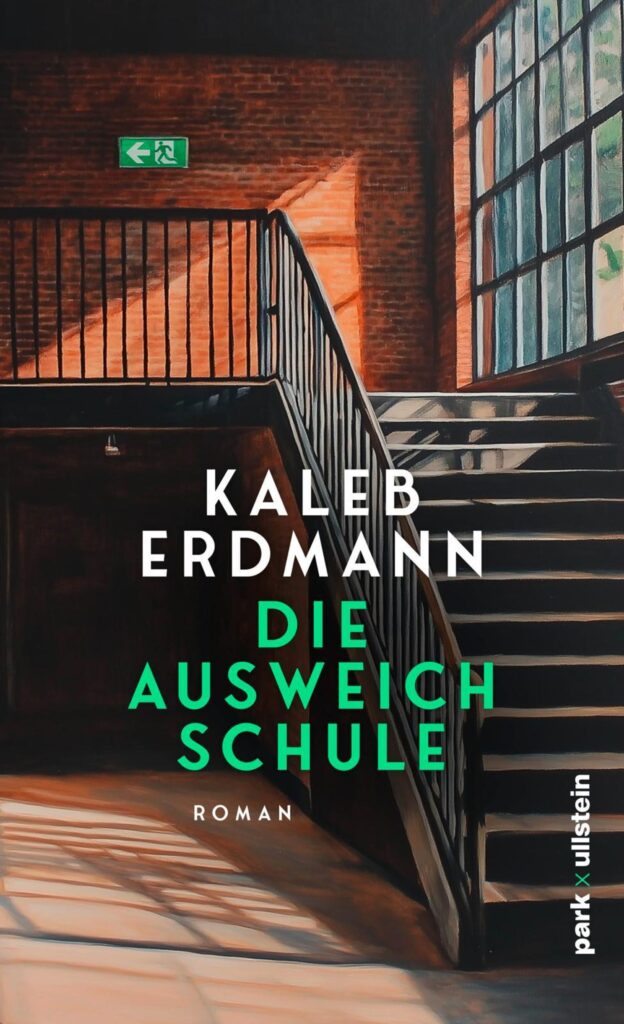
// Viele Bücher liest man, und danach klappt man sie zu und geht einfach wieder in den Alltag zurück. Und dann gibt es jene wenigen Werke, die man mit sich herumschleppt – wie eine zweite Haut, die auch Tage später noch nicht von einem abfällt. Kaleb Erdmanns Die Ausweichschule gehört eindeutig in die zweite Kategorie. Ich habe selten ein Debüt gelesen, das so präzise und zugleich schonungslos ehrlich an ein kollektives Trauma herantritt. Der Amoklauf von Erfurt 2002 ist vielen von uns noch als bedrückende Fernsehbilder im Gedächtnis. Erdmann aber lässt uns diesen Tag nicht durch Nachrichten oder Fakten erleben, sondern durch die Augen eines damals elfjährigen Jungen, der die Schüsse hört und die Sprachlosigkeit der Erwachsenen danach mitträgt. Diese Perspektive – ein Kind, das viel wahrnimmt, aber noch nicht über die Werkzeuge verfügt, all das zu deuten – ist einer der stärksten und zugleich schmerzhaftesten Aspekte des Romans. Besonders beeindruckt hat mich, wie Die Ausweichschule mit der Frage ringt, was Erinnern überhaupt bedeutet.
Mehr als zwanzig Jahre später versucht der Erzähler, ein Buch über das Geschehen zu schreiben – und merkt, dass er sich selbst in diesem Versuch verstrickt. Er hadert mit der Verantwortung: Darf man ein solches Trauma literarisch ausschlachten? Oder schuldet man der eigenen Erinnerung gerade diese Form der Verdichtung? Dieses Spannungsfeld macht das Buch so unmittelbar und aktuell, denn es geht nicht nur um Erfurt, sondern um die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft mit Gewalt, mit Gedenken und mit Erzählen umgehen. Erdmann schreibt in einer Sprache, die zugleich schlicht und kunstvoll ist. Keine überflüssigen Ausschmückungen, sondern klare, fast spröde Sätze, die gerade dadurch unter die Haut gehen. Manchmal wirken die Abschnitte wie Notizen, wie vorsichtig gesetzte Schritte, als sei selbst das Erzählen ein Balanceakt. Dann wieder weitet sich der Ton ins Essayistische, ohne je belehrend zu werden. Für mich ist das genau die richtige Mischung. Was mir beim Lesen immer wieder durch den Kopf ging: Die Ausweichschule ist nicht nur ein Buch über ein schreckliches Ereignis, sondern auch über die Unmöglichkeit, endgültig darüber zu sprechen. Jede Erinnerung verändert sich, jedes Erzählen schafft eine neue Schicht. Das macht den Roman zu einem doppelten Dokument – einer persönlichen Spurensuche und einer literarischen Reflexion über Erinnerung selbst. Ich habe beim Lesen mehrmals innehalten müssen, um Luft zu holen. Erdmanns Text konfrontiert einen, zwingt zur Auseinandersetzung, aber er lässt auch Raum für eigene Gedanken und Erinnerungen. Und genau das macht ihn so wertvoll. Die Ausweichschule ist kein leichtes Buch. Aber es ist eines, das man lesen muss. Weil es uns daran erinnert, dass hinter Schlagzeilen immer Menschen stehen. Weil es zeigt, wie Erinnerung funktioniert – oder eben nicht funktioniert. Und weil Kaleb Erdmann den Mut hatte, nicht nur von einem Trauma zu erzählen, sondern von der Zerbrechlichkeit des Erzählens selbst. Für mich schon jetzt eines der wichtigsten Bücher des Jahres 2025 und völlig zu Recht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.
UND WAS NUN?