mit dem Werken „Asa“ von Zoran Drevenkar und den für den Deutschen Buchpreis nominiertem Werk „Im Herzen der Katze“ von Jina Khayyer.
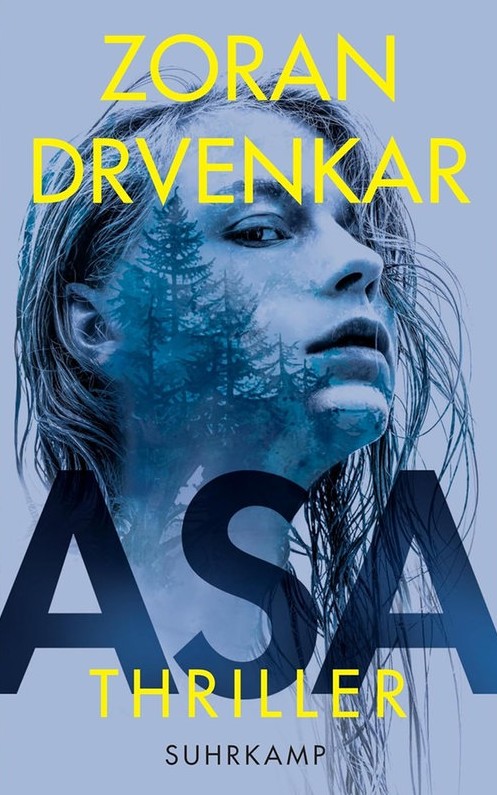
// Zoran Drvenkar entfaltet in Asa einen monumentalen Roman, welcher Thriller, Rachegeschichte und düstere Familiensaga zugleich ist. Über 700 Seiten hinweg entwickelt er eine Erzählung, die von einer Intensität und sprachlichen Wucht getragen wird, wie man sie nur selten findet. Im Zentrum steht Asa, eine Frau, die nach sechs Jahren Haft zurückkehrt, um eine Tradition zu zerstören, die seit über hundert Jahren das Leben einer Gemeinschaft bestimmt – eine Tradition, die auf Gewalt, Machtmissbrauch und dem Tod unzähliger Unschuldiger gründet. Drvenkar zeigt Asa als verletzte, aber unbeugsame Figur, die sich weigert, die ihr zugedachte Opferrolle weiterzuführen. Der Roman macht deutlich, wie sehr Gewalt sich innerhalb von Familienstrukturen vererbt, wie Loyalität und Verrat eng miteinander verwoben sind und wie schwer es ist, sich aus diesem Kreislauf zu befreien.
Zugleich wird Asa zu einem epischen Panorama über menschliche Abgründe: über die Macht der Herkunft, über die schmerzhafte Suche nach Identität und über den Versuch, die Ketten der Vergangenheit zu sprengen. Mit seiner präzisen, oft gnadenlosen Sprache erzeugt Drvenkar eine düstere, beinahe mythische Atmosphäre, die den Roman weit über den klassischen Thriller hinaushebt und ihn zu einer Parabel über Schuld, Rache und Selbstermächtigung macht.
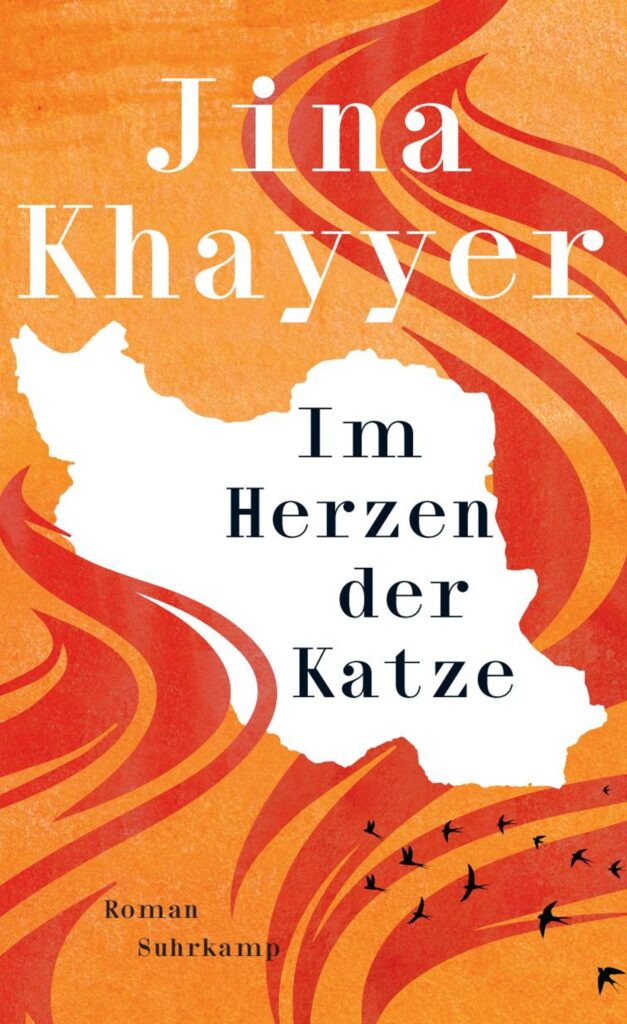
Jina Khayyer wählt mit ihrem für den Deutschen Buchpreis nominierten Werk Im Herzen der Katze eine ganz andere Form der Intensität, die weniger aus der Wucht äußerer Ereignisse entsteht, sondern aus der stillen, poetischen Kraft der Erinnerung und des persönlichen Erlebens. Ihr Roman, der in diesem Jahr auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis steht, beginnt mit einem Schock: dem Tod von Jina Mahsa Amini im Iran, deren Name sich mit dem der Autorin überlagert. Dieser Moment wirkt wie ein Riss, durch den Vergangenheit und Gegenwart, Privates und Politisches ineinanderfließen. Die Erzählerin sitzt in Südfrankreich, das Smartphone in der Hand, und folgt in Echtzeit den Protesten, während sie zugleich in Erinnerungen an ihre Aufenthalte im Iran zurückkehrt. Khayyer erzählt von der Wärme und Gastfreundschaft der Menschen, von Familienritualen und von einer heimlichen Liebe – und stellt diesen Bildern die Brutalität von Polizeigewalt, Repression und politischem Widerstand gegenüber. Dabei entstehen eindringliche Kontraste: die leuchtenden, fast zärtlichen Szenen einer Kindheit und Jugend im Iran einerseits, die Härte und Gefahr des Widerstands andererseits. Im Herzen der Katze ist damit nicht nur ein Familien- und Liebesroman, sondern auch eine literarische Erkundung dessen, wie sehr Herkunft, Identität und Freiheit miteinander verknüpft sind. Khayyer gelingt es, aus ganz persönlichen Erfahrungen eine Geschichte zu weben, die universell berührt, weil sie von Mut, Solidarität und der Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben erzählt. Setzt man beide Bücher in Beziehung, so zeigt sich eine überraschende Verwandtschaft jenseits ihrer unterschiedlichen literarischen Formen. Sowohl Drvenkar als auch Khayyer erzählen von der Gewalt, die sich in Familien und Gesellschaften fortsetzt, und von Frauen, die nicht länger bereit sind, diese Gewalt hinzunehmen. Asa kämpft in einem archaisch anmutenden Setting gegen eine zerstörerische Familientradition, während Khayyers Erzählerin die Bilder von mutigen Frauen im Iran betrachtet, die ihr eigenes Leben riskieren, um für Freiheit und Selbstbestimmung einzutreten. In beiden Fällen geht es um den Moment, in dem das Opfer die eigene Ohnmacht überwindet und in Handlung umschlägt – sei es durch den Weg der Rache oder durch den der Solidarität. Dabei sind auch die Kontraste aufschlussreich: Asa ist ein wilder, epischer Pageturner voller Gewalt und Rache, Im Herzen der Katze hingegen ein leiser, poetischer Roman, der Erinnerung und Gegenwart ineinanderfließen lässt. Doch beide Texte verhandeln die gleichen Grundfragen: Wie überwindet man die Last der Vergangenheit? Wie findet man Freiheit inmitten von Zwang, Tradition und Gewalt? Und wie sehr kann Literatur ein Raum sein, in dem der Schmerz in Sprache verwandelt wird, um ihn nicht nur individuell, sondern auch kollektiv zu tragen?
UND WAS NUN?