mit dem Werk „Was wir wissen können“ von Ian McEwan.
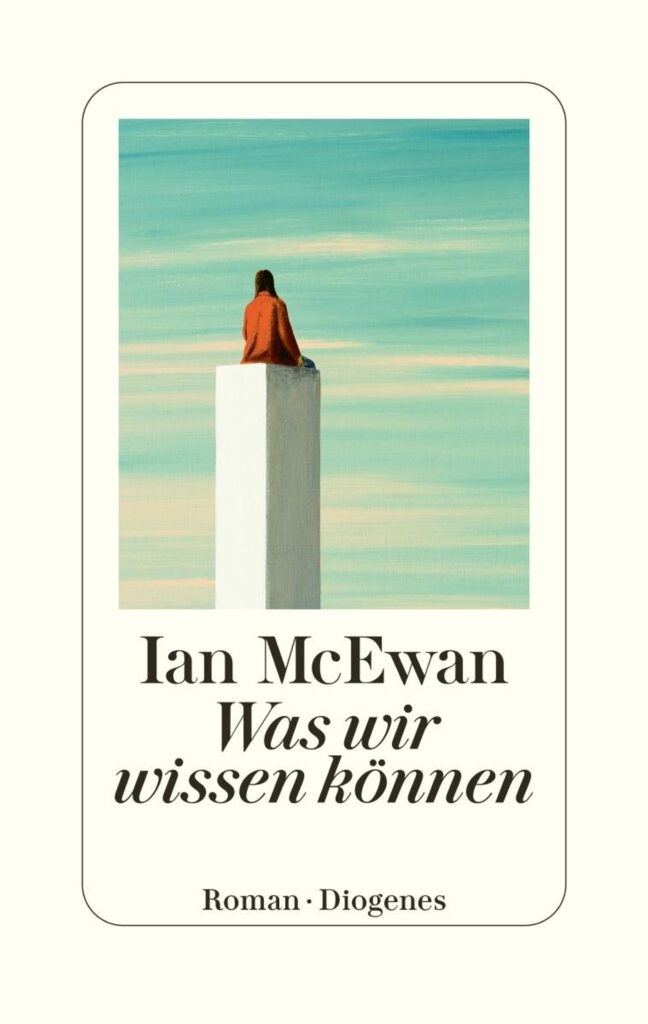
// Mit Was wir wissen können legt Ian McEwan einen Roman vor, der zugleich Zukunftsvision, Liebesgeschichte und literarische Spurensuche ist. Schon die Prämisse klingt typisch für McEwan: Ein Mann auf der Suche nach einem verlorenen Gedicht, einer Wahrheit, die vielleicht nie ganz zu fassen ist – und dahinter die große Frage, was Wissen, Erinnerung und Wahrheit in einer zerstörten Welt überhaupt noch bedeuten. Die Handlung führt uns in das Jahr 2119. Die Welt ist überflutet, Europa besteht aus Inseln, die Zivilisation unserer Gegenwart ist nur noch eine ferne Erinnerung. Der Literaturwissenschaftler Thomas Metcalfe macht sich auf die Suche nach einem legendären Gedicht des Dichters Francis Blundy, das dieser einst seiner Frau Vivien gewidmet hat. Das Gedicht wurde nur einmal vorgetragen, dann verschwand es – und mit ihm die Wahrheit über eine Liebe, die, wie sich herausstellt, vielschichtiger war, als die Legenden glauben lassen. In den Spuren, Tagebüchern und Briefen des Paares stößt Thomas auf eine geheime Affäre, auf Verrat – und schließlich auf ein Verbrechen, das bis in die Gegenwart der überfluteten Welt ausstrahlt. McEwan war schon immer ein Autor, der die Balance zwischen präziser Intellektualität und emotionaler Wucht beherrscht.
Auch hier gelingt ihm das auf beeindruckende Weise. Obwohl der Roman in einer dystopischen Zukunft spielt, wirkt er nicht wie Science-Fiction im klassischen Sinn. Die Überflutung der Welt, das Zerfallen alter Sicherheiten, sind vielmehr Spiegelbilder unseres gegenwärtigen Zustands – eine Weiterführung unserer Gegenwart ins Unvermeidliche. Was mich dabei besonders beeindruckt hat, ist die Ruhe, mit der McEwan diese Welt beschreibt: keine übertriebene Dramatik, sondern eine leise, fast melancholische Klarheit, die an seine großen Romane wie Abbitte oder Maschinen wie ich erinnert. Thomas Metcalfe ist ein typischer McEwan-Held – intellektuell, zweifelnd, von einer leisen moralischen Unruhe durchdrungen. Seine Suche nach dem Gedicht wird zu einer Suche nach Orientierung in einer Welt, in der Wissen längst keine feste Größe mehr ist. Immer wieder reflektiert der Text, was „Erkenntnis“ überhaupt bedeutet: Ist Wissen etwas, das uns rettet, oder nur ein schöner Irrtum, der uns glauben lässt, wir hätten verstanden? Diese philosophische Dimension zieht sich still, aber beständig durch den ganzen Roman und verleiht ihm eine Tiefenschärfe, wie sie nur wenige Gegenwartsautoren erreichen. Bernhard Robben, McEwans langjähriger Übersetzer, fängt diesen Ton mit gewohnter Eleganz ein. Seine Sprache ist präzise, unaufdringlich und trägt den leisen Rhythmus von McEwans Prosa mühelos ins Deutsche hinüber. Man spürt beim Lesen, dass hier zwei Künstler einander seit Jahrzehnten verstehen. Was Was wir wissen können für mich besonders lesenswert macht, ist seine Mischung aus Intellekt und Intimität. Es ist ein Buch über Literatur und über Liebe, über das, was bleibt, wenn beides verloren geht. McEwan zeigt, dass auch in einer untergegangenen Welt die menschliche Sehnsucht nach Bedeutung nicht stirbt – sie verändert nur ihre Gestalt. Am Ende steht kein eindeutiges Wissen, keine Lösung, sondern ein Staunen über das, was Menschen zu glauben bereit sind. So ist dieser Roman ein stilles, kluges, zutiefst menschliches Werk – vielleicht weniger spektakulär als frühere McEwan-Texte, aber umso reifer, nachdenklicher, eindringlicher. Was wir wissen können erinnert uns daran, dass Literatur selbst eine Form des Überlebens ist: das hartnäckige Bemühen, etwas festzuhalten, das sonst im Wasser der Zeit versinken würde.
UND WAS NUN?