mit dem Werk „Capital B“ von Florian Opitz.
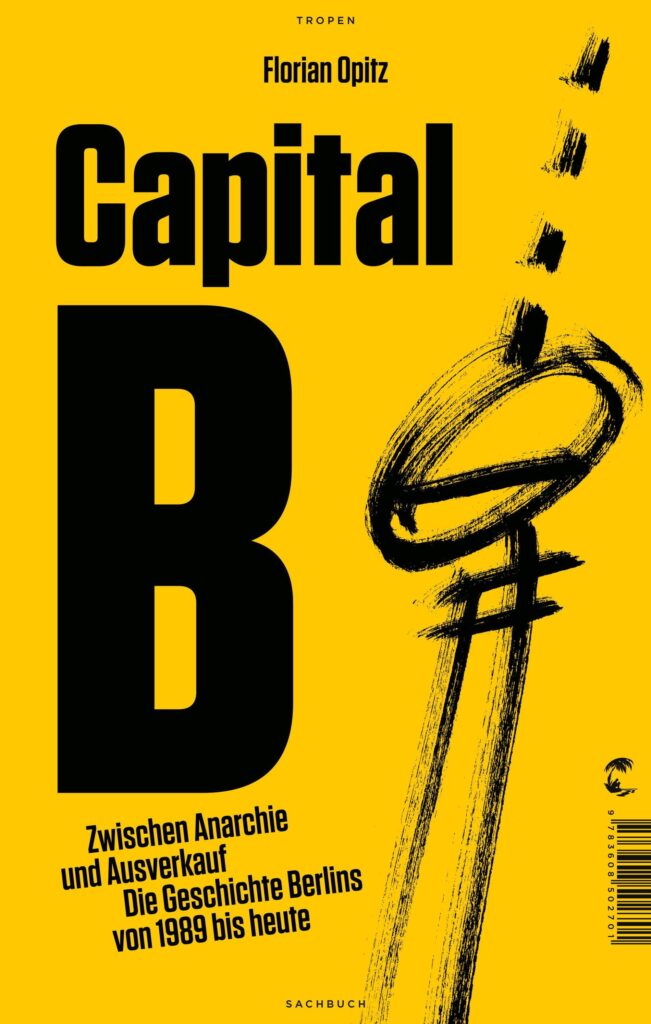
// Wenn man in Berlin lebt – oder gelebt hat, oder auch nur halbherzig mit dem Gedanken spielte – dann fühlt sich Capital B nicht wie ein Buch an, sondern wie ein wuchtiger Spiegel, der einem mit aller Wucht vor die Stirn knallt. Florian Opitz hat hier nicht einfach ein Stadtporträt geschrieben. Er hat einen rasenden, schillernden, vielstimmigen Trip durch über 30 Jahre Hauptstadtwahnsinn hingelegt – und dabei eine Erzählform gewählt, die so roh, direkt und unverstellt ist wie Berlin selbst. Was dieses Buch so mitreißend macht, ist nicht nur die schiere Menge an Stoff, an Protagonist*innen, an Geschichten – sondern die Art, wie Opitz es schafft, aus diesem Chaos eine greifbare Dramaturgie zu bauen. Vom Umbruchsjahr 1989, das nicht nur die Mauer, sondern ganze Weltbilder einstürzen ließ, bis hin zur Gegenwart, in der Berlin längst keine anarchische Spielwiese mehr ist, sondern ein heiß umkämpfter globaler Standort für Investoren, Kreative, Kriminelle, Kapital und Kollaps. Opitz stellt keine Thesen auf, die er dann trocken abarbeitet. Er lässt die Stadt erzählen. Und sie erzählt in vielen Stimmen, vielen Tönen, manchmal schreiend, manchmal flüsternd – aber immer ehrlich. Was mich besonders gepackt hat, war die Vielschichtigkeit. Auf der einen Seite die euphorischen Aufbruchsgefühle der frühen 90er: besetzte Häuser, illegale Raves in Ruinen, ein kollektives Gefühl von: „Alles ist möglich.“
Auf der anderen Seite aber auch die kalte Realität, wie dieses „Alles“ nach und nach filetiert wurde – von Investoren, von politischen Machenschaften, von einem System, das längst nicht mehr fragt, ob ein Ort lebenswert ist, sondern ob er Rendite bringt. Die Mischung aus Interviews, Porträts und historischen Abrissen funktioniert dabei erstaunlich gut. Man spürt, dass Opitz vom Film kommt – das Tempo ist hoch, die Bilder klar, die Übergänge oft filmisch gedacht. Und gerade durch die Vielfalt der Perspektiven entsteht ein Berlin, das nie eindeutig zu greifen ist: Peter Fox und sein Berlin-Liebeslied sind ebenso Teil dieser Geschichte wie Dimitri Hegemann, der aus einem alten Heizkraftwerk den Tresor gemacht hat, oder Pamela Schobeß, die im Clubkollektiv für eine faire Kulturlandschaft kämpft. Dazu zahlreiche Menschen, die Berlin geprägt haben, indem sie es gestalten oder gegen die Wand gefahren haben. Oft beides. Opitz bringt vieles zurück ins Bewusstsein, was überlagert wurde – von der Geschwindigkeit der Stadt, von persönlichen Erinnerungen, von gezielter politischer Verdrängung. Es ist kein nostalgisches Buch, obwohl Nostalgie hier und da durchblitzt. Es ist vor allem ein ehrliches. Und das ist vielleicht das größte Kompliment, das man einem Buch über Berlin machen kann. Capital B ist keine Wohlfühllektüre. Es ist eine Zumutung im besten Sinne – wütend, traurig, wild, vollgepackt mit Fakten und Schicksalen, und dabei immer mit dem Blick auf das große Ganze. Wer Berlin verstehen will, jenseits von Touri-Klischees und Instagram-Schnappschüssen, der findet hier den Schlüssel. Einen rauen, schweren, kantigen Schlüssel. Ich habe das Buch mit einem Gefühl von Melancholie, Wut und – trotz allem – Zuneigung aus der Hand gelegt. Zuneigung zu einer Stadt, die sich ständig neu erfindet, und dabei jedes Mal ein Stück ihrer Seele verkauft. Und trotzdem bleibt. Florian Opitz ist mit Capital B ein echtes Zeitdokument gelungen. Kein trockener Geschichtsband, sondern ein vibrierendes Mosaik aus Stimmen, Kämpfen und Kompromissen. Es ist ein Buch, das nachhallt. Und das man wahrscheinlich in zehn Jahren noch einmal lesen muss – um zu sehen, wie viel Berlin dann noch übrig ist.
UND WAS NUN?