mit den Werken „Buch der Gesichter“ und „Das Geschenk“.
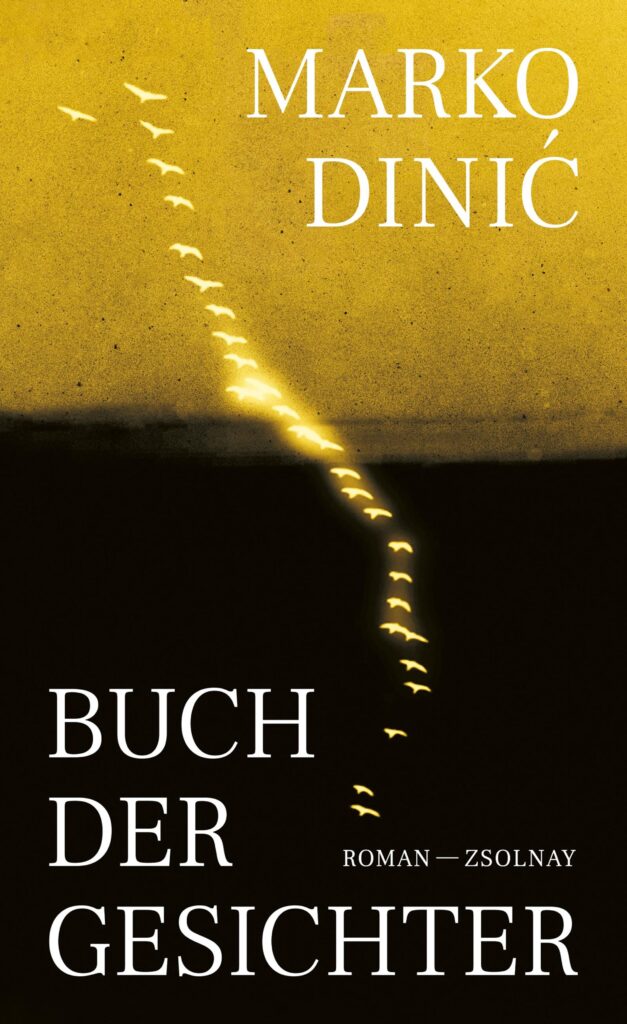
// Es ist selten, dass zwei Bücher aus demselben Verlag so unterschiedlich daherkommen und doch auf einer tieferen Ebene eng miteinander verbunden scheinen. Marko Dinićs eben erst auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gesetztes Werk Buch der Gesichter und Gaea Schoeters’ Das Geschenk erzählen auf den ersten Blick vollkommen verschiedene Geschichten – hier das von Gewalt, Erinnerung und Identität gezeichnete Belgrad des Jahres 1942, dort eine schrille, beinahe satirische Parabel, in der 20.000 Elefanten in deutschen Großstädten auftauchen. Und doch kreisen beide Werke um dieselbe Frage: Wie gehen wir als Gesellschaft mit unserer Vergangenheit, unserer Verantwortung und den Folgen unserer Entscheidungen um? Dinić führt uns in ein Serbien, das im Zweiten Weltkrieg vom Terror der Besatzung und der Shoah überschattet ist. Sein Protagonist Isak Ras irrt durch eine Stadt, die zugleich Labyrinth und Abgrund ist, auf der Suche nach Antworten, die ihm vielleicht schon niemand mehr geben kann.
Dass Dinić diese Spurensuche aus acht Perspektiven erzählt, die sich am Ende wie ein rätselhaftes Mosaik zusammensetzen, macht die Lektüre anspruchsvoll, aber auch ungemein lohnend. Es ist ein Roman, der Erinnerung nicht nur abbildet, sondern sie auf nachdrückliche Weise erfahrbar macht: Wie unscharf, wie gebrochen, wie vielstimmig Geschichte auch immer ist.
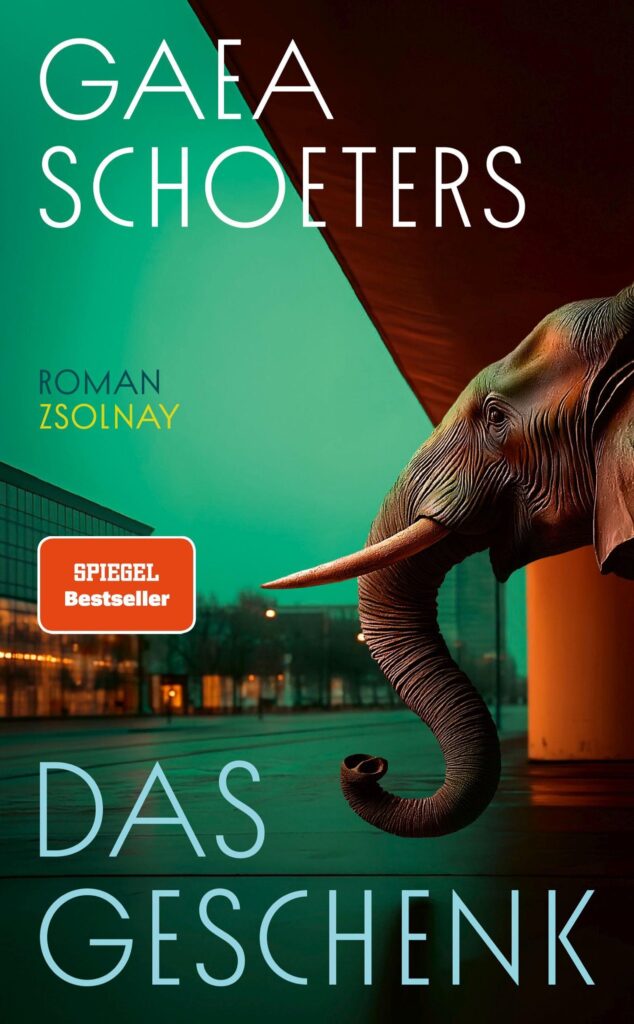
Ganz anders Schoeters: Ihr Geschenk ist ein scharfes, spielerisches Gedankenspiel, das sich fast wie ein modernes Märchen liest. Elefanten, die durch deutsche Straßen stapfen – diese groteske Szenerie ist mehr als ein surrealer Einfall. Sie entlarvt die Schieflagen in der globalen Verantwortung: Europäische Politik trifft Entscheidungen mit moralischem Gestus, aber die Konsequenzen müssen andere tragen. Der Präsident Botswanas kehrt das Verhältnis einfach um, und plötzlich steht der deutsche Kanzler vor dem Problem, 20.000 Elefanten unterzubringen. Es ist absurd, komisch und zugleich todernst – ein Spiegel, der die Bequemlichkeit europäischer Haltung gnadenlos beleuchtet. Was beide Bücher eint, ist der Mut, historische und gegenwärtige Fragen literarisch radikal anders zu erzählen. Dinić verknüpft Erinnerungsliteratur mit der Form eines Rätsels, bei dem der Leser selbst Detektiv wird. Schoeters greift ins Arsenal der Satire und Fabel, um den moralischen Zeigefinger durch Humor zu ersetzen – und gerade dadurch umso schärfer zu treffen. Beide Bücher verweigern sich der simplen Belehrung. Sie zwingen ihre Leser, selbst zu deuten, zu vergleichen, Schlüsse zu ziehen. Ich habe beim Lesen das Gefühl gehabt, zwei Seiten einer Medaille vor mir zu haben: Buch der Gesichter zeigt, wie die Gewalt der Vergangenheit sich in Biografien und Erinnerung einschreibt. Das Geschenk zeigt, wie politische Verantwortung in der Gegenwart verdrängt und verschoben wird, bis sie – in Gestalt von Elefanten – nicht mehr zu ignorieren ist. Während Dinić in die Tiefenschichten des 20. Jahrhunderts hinabsteigt, springt Schoeters mitten hinein in die Gegenwart und entlarvt deren Widersprüche. Zusammen gelesen, ergeben diese beiden Bücher fast schon einen Dialog über Europa – über Schuld, Verantwortung, Überheblichkeit und die Frage, was wir bereit sind zu sehen und zu tragen.
UND WAS NUN?